Archiv
Wir, die Objektiven vom 10. März 2025
Lesefrucht vom 23. Dezember 2025
Mein kleiner Laden vom 3. Dezember 2025
Eskapismus vom 26. November 2024
Treu gedient vom 9. November 2024
Allgemeiner Trend vom 17. Oktober 2024
Immer wieder Österreich! vom 1. Oktober 2024
Silbenakrobatik vom 24. September 2024
Wieder an Bord vom 29. Juli 2024
Mit der Natur versöhnt vom 4. Juni 2024
Radio Pigafetta vom 9. Mai 2024
Alle Räder stehen still, wenn der böse Marder will vom 8. Mai 2024
Sammlerstück vom 12. April 2024
Verbrenner vom 2. April 2024
Usern von Online-Foren zur Warnung vom 20. März 2024
Kriegsversehrt vom 23. Februar 2024
Die Remigration der Mauren vom 29. Januar 2024
Verraten und verkauft vom 15. Januar 2024
Mein Lieblingsfest (Tribute to Christoph & Lollo) vom 16. Dezember 2024
Die vielen Leben des Oscar Koelliker vom 16. November 2023
Von Zeit zu Zeit seh ich vom 25. Oktober 2023
Ka-em-ha vom 6. Oktober 2023
Was lange gärt, wird endlich Wut vom 21. September 2023
Maschinenpark vom 5. September 2023
Der Brotfachverkäufer*in vom 3. August 2023
So grün, wenn Spaniens Blüten vom 30. Juli 2023
Schlieren der Schöpfung vom 2. Juli 2023
Penem et circenses vom 7. Juni 2023
Copy if you can vom 17. Mai 2023
Populisten vom 17. April 2023
Der Rechner Fantasie vom 1. April 2023
Die großen Gräben vom 20. März 2023
Minimalinvasiv vom 14. März 2023
Klingt Sägelärm vom Forste vom 8. März 2023
Business-Kollektion vom 27. Februar 2023
Der mit dem Hund tanzt vom 15. Februar 2023
Normalerweise vom 13. Februar 2023
Adiós, Magellan! vom 31. Januar 2023
In memoriam Heinz Erhardt vom 29. Dezember 2022
Das Mäusekrematorium vom 12. Dezember 2022
Schein oder nicht Schein vom 15. November 2022
Sie wollen wieder schießen (dürfen) vom 5. Oktober 2022
Auf der Matte am Morgen vom 6. September 2022
Friede den Hütten! vom 24. August 2022
Abschnitt 4 EuGVVO ist nicht anzuwenden vom 21. Juni 2022
Mit dem Hundeschlitten zum Stephansdom vom 9. Mai 2022
Meine Arbeit vom 4. April 2022
Wer eine Meise hat vom 15. März 2022
Völkerfreundschaft im Klassenzimmer vom 21. Februar 2022
Omikron vom 7. Februar 2022
Ewig bleibt im Ohr der Klang vom 3. Januar 2022
Auf der Suche nach Hans vom 23. Dezember 2021
Impfen und Freiheit vom 24. November 2021
Überlegungen zur bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs vom 21. September 2021
Alles gut vom 8. September 2021
Shisha-Kohle an Bord vom 25. Juli 2021
Land der Autoholiker vom 30. Juni 2021
Mit Magellan und Pigafetta (noch nicht) nach Reutlingen vom 21. Juni 2021
Hitler, Magellan und Stefan Zweig vom 21. Mai 2021
Wunder für die Augen: Islamische Weltkarten vom 26. April 2021
Frosch oder Vogel? vom 19. April 2021
Zeichen der Zeit vom 28. März 2021
Dieses Spiel geht nur zu zweit vom 8. März 2021
Skifoan! vom 22. Februar 2021
Hauptsache gesund vom 22. Februar 2021
Pigafetta im Radio vom 12. Januar 2021
Maßloses Wünschen vom 22. Dezember 2020
Weiße Götter, braune Naturkinder vom 26. November 2020
Was 11.000 Jungfrauen mit einem Kap in Argentinien zu tun haben vom 20. Oktober 2020
An Bord mit Magellan vom 21. September 2020
1000 Jahre Globalisierung? vom 31. August 2020
Neues von Pigafetta vom 19. Mai 2020
Verdachtsunabhängige Kontrolle vom 17. April 2020
Der Heilige Hiob auf Timor vom 23. März 2020
Autorenlesung in Entringen vom 28. Januar 2020
„… dass wir die gesamte Rundung der Welt entdeckt haben.“ vom 12. Dezember 2019
Erste Erdumrundung on air vom 13. September 2019
Ein halbes Jahrtausend vom 13. August 2019
Spektroskopie vom 24. Juni 2019
Das Pigafetta-Projekt vom 3. Juni 2019
Werk.Gänge vom 18. Mai 2019
Ankündigung: Lesung bei München vom 24. April 2019
Schall und Rauch vom 31. März 2019
Magellan-Mythen vom 8. März 2019
Buch ahoi! vom 13. Februar 2019
Der (un)romantische Magellan vom 28. Januar 2019
>> nach oben
Wir, die Objektiven
Veröffentlicht am 10. März 2025
Als regelmäßiger Konsument dieser Reality-Show namens „Politik“ komme ich mir derzeit vor wie in dem alten Witz, wo einer sagt: Setz dich erstmal ruhig hin und atme tief durch, es könnte schlimmer kommen, und du setzt dich ruhig hin, atmest tief durch, und es kommt schlimmer.
Dabei hat das ganze etwas Gespenstisches, weil der Alltag in unseren Wohnungen und Büros scheinbar unbeschadet weitergeht – wie an jenem 11. September, als wir vor dem Fernseher zusahen, wie die zwei Türme einstürzten. So können wir jetzt live dabei zuschauen, wie das Kartenhaus aus Heuchelei und Illusionen, das wir „Weltordnung“ nannten und von dem wir meinten, es sei in Stein gemeißelt, auseinanderfliegt.
Schon einmal habe ich eine Zeit erlebt, in der sich die Ereignisse derart überschlugen, dass ich kaum hinterher kam: nach dem 9. November 1989, als die Mauer über Nacht zerbröckelte und mit ihr die Weltordnung, die sie symbolisierte.
In der Erinnerung vieler Leute – auch solcher, die sie wie meine Tochter nicht selbst erlebt haben – ist diese Zeit mit positiven Gefühlen verbunden: eine Zeit des Aufbruchs, der Hoffnungen, grenzenloser Freiheit. Aus heutiger Perspektive erkennt man eher eine Epoche des Leichtsinns, der ungenutzten Chancen und falschen Versprechungen.
Die Wiedervereinigung und das Internet waren für meine Generation wohl die größten Umwälzungen jener Jahre. Beide wurden mit geradezu millenaristischer Euphorie gefeiert. Beide haben sich als demokratiepolitische Desaster erwiesen. Und die dritte große Hoffnung, nein, eigentlich gewisse Erwartung meiner Generation – Europa? Immerhin, die Union gibt es noch.
In meiner persönlichen Erinnerung sind die Jahre Ende der 80er, Anfang der 90er alles andere als rosarot getönt. Die Dynamik des Umbruchs damals verunsicherte mich, ebenso die Gewalt, die mit ihm einherging. Der auf einmal wieder grassierende Nationalismus in Deutschland, in Osteuropa. Brennende Asylantenheime, „Glatzenstress“ nachts auf den Straßen. Boom der organisierten Kriminalität. Die Sorge: Was wird aus den sowjetischen Atomwaffen? Krieg im zerfallenden Jugoslawien, Krieg in der zerfallenden UdSSR: Bergkarabach, Abchasien, Südossetien. Tschetschenien. Islamismus und Staatsterror in Algerien. Und schließlich: Ruanda.
Während des Bosnienkriegs ab 1992 nahm die Dichte an Horrormeldungen derart zu, dass ich monatelang gar keine Nachrichten mehr verfolgte. Das ging damals leichter als heute, vor allem wenn man wie ich keinen Fernseher hatte. Aber die Augen vor der Welt und ihren Gefahren zu verschließen, ist auf Dauer auch keine Lösung.
Ist die Welt heute gefährlicher als vor dreißig Jahren? Für uns Mitteleuropäer wahrscheinlich ja. Dennoch sind Illusionen etwas, dessen Verlust ich nicht beklagen kann. So übertrieben ich damals den Optimismus meiner Zeitgenossen fand, so kleinmütig finde ich heute ihren Pessimismus. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wussten es noch nie.
Aber wir wissen, was auf dem Spiel steht. Frieden ohne Freiheit ist wertlos. Und Freiheit ohne Gerechtigkeit ist Tyrannei. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Menschen in der Ukraine, die seit Jahren gegen das Unrecht kämpfen. Ihre Niederlagen nämlich beweisen nichts, als dass sie zu wenige sind …
Lassen wir die Ukraine nicht im Stich!
>> nach oben
Lesefrucht
Veröffentlicht am 23. Dezember 2024
„Man braucht sich vor den wilden Männern nämlich nie zu fürchten. Je mehr wirklich in ihnen steckt, desto eher bequemen sie sich den wirklichen Verhältnissen an, wenn man ihnen Gelegenheit dazu gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, aber es hat noch nie eine Opposition gegeben, die nicht aufgehört hätte, Opposition zu machen, wenn sie ans Ruder gekommen ist; das ist nämlich nicht bloß so, wie man glauben könnte, daß es sich von selbst versteht, sondern das ist etwas sehr Wichtiges, denn daraus entsteht, wenn ich mich so ausdrücken darf, das Tatsächliche, Verläßliche und Kontinuierliche in der Politik!“
Graf Leinsdorf („Se. Erlaucht“)
>> nach oben
Mein kleiner Laden
Veröffentlicht am 3. Dezember 2024
Stellen sie sich diesen Webauftritt vor wie einen jener kleinstädtischen Läden, deren Auslagen man ansieht, dass die Inhaber schon länger nicht mehr in ihr Geschäft investiert haben: das Schaufenster leicht trübe, die Fotos verblichen, die spärlichen Waren nicht mehr der neuste Schrei, aus dem Postkasten quillt Werbung, und die eigenartigen Öffnungszeiten künden weder von reger Nachfrage noch von ausuferndem Arbeitseifer.
Leben können die davon nicht, denkt vielleicht, wer an einem solchen Laden vorbeigeht, und dass die Eigentümer – müssten sie Miete zahlen, hätten sie längst zugesperrt – wohl bald in Pension gehen. Letzteres trifft in diesem Fall nicht zu (und wird angesichts meiner Rentenprognose auch nie eintreten), ersteres durchaus. Aber das mit dem mangelnden Arbeitseifer würde ich doch gern richtigstellen.
Hinter dem Laden befindet sich eine kleine Werkstatt, mit einem Ofen, Bücherregalen und einem Schreibtisch, an dem der Besitzer Tag für Tag seinem Handwerk nachgeht. Hin und wieder arbeitet er auf Bestellung, das ein oder andere Stück kommt in die Auslage, manches wieder ist nur für den Hausgebrauch. Und dann ist da noch das große Werk, an dem er seit Jahr und Tag spinnt und webt und von dem er nicht weiß, ob er es jemals vollenden wird.
Wer öfters vorbeikommt und vor dem Schaufenster stehen bleibt, wird bemerken, dass die Auslage sich immer wieder verändert. Ab und zu wird aufgeräumt, neue Dinge kommen hinein, und manchmal kann man abends sogar Licht sehen, das in der Werkstatt brennt und durch einen Türspalt in den Ladenraum fällt.
>> nach oben
Eskapismus
Veröffentlicht am 26. November 2024
Es gibt genügend Ungemach auf Erden Und Dinge, die den Tag dir bald vergrämen. Die Medien sind voll von düstern Themen, Die Welt ein Dorf mit lauter Krisenherden. Sie wollen nicht ganz ernst genommen werden, Doch ihre Gegner müssen sie ernst nehmen, Und rühren sie dich auch nicht gleich zu Tränen, So werden sie den Tag dir nie verderben. Wenn du mal ein Problem hast, brauchst du nur Das A-Team einzuschalten. Hannibal Hat immer einen Plan, und mit Bravour Tun Faceman, Murdock und B.A. ganz schnell, Was nötig ist – der Rest ist Action pur. Und schon ist meine Stimmung wieder hell.
>> nach oben
Treu gedient
Veröffentlicht am 9. November 2024
Dass angesichts der Wiedervereinigung keine Euphorie angebracht war, haben trotz ihrer Jugend hellsichtige Geister wie ich schon 1990 geahnt. Unsere größte Sorge war damals, dass liebgewonnene Errungenschaften der in der DDR entfalteten Produktivkräfte nun abgewickelt würden: etwa die real-existierende Satirezeitschrift „Junge Welt“, die Briefmarken mit den aufmunternden Parolen und vor allem natürlich die köstliche Koffeinbrause „Club-Cola“.
 Denn die meisten DDR-Bürger wollten erklärtermaßen ja keine Freiheit, sondern „Marlboro, Golf GTI und ’nen Videorecorder“. Doch wir haben den Kapitalismus unterschätzt. Er ist in der Lage, alles, aber auch wirklich alles in Waren zu verwandeln, also nicht nur profane Dinge wie Gesundheit, Bildung und Liebe, sondern auch die Erinnerung an das real-existierende Glück hinter sozialistischen Mauern.
Denn die meisten DDR-Bürger wollten erklärtermaßen ja keine Freiheit, sondern „Marlboro, Golf GTI und ’nen Videorecorder“. Doch wir haben den Kapitalismus unterschätzt. Er ist in der Lage, alles, aber auch wirklich alles in Waren zu verwandeln, also nicht nur profane Dinge wie Gesundheit, Bildung und Liebe, sondern auch die Erinnerung an das real-existierende Glück hinter sozialistischen Mauern.
So kommt es, dass sich diese Erinnerung heutzutage mit einer breiten Palette von Konsumartikeln pflegen lässt, die Markennamen von ehemaligen Ostprodukten tragen und dank Internet nun auch im Westen käuflich sind: Halloren-Kugeln, Rotkäppchen „Mocca Perle halbtrocken“, Rasierwasser „TÜFF ROT“ und und und. Auch Club-Cola wird weiter produziert, wenn auch „Nicht für jeden. Nur für uns.“
 Selbst wenn es sich um einen Nischenmarkt handeln mag: Studiert man das Angebot von spezialisierten Online-Händlern wie „ossiladen.de“, gewinnt man den Eindruck, dass der Sozialismus sich 2024 einer Produktivität und Nachfrage erfreut, die ihm vor 1989 versagt blieben. Wie viele der damals 2,7 Millionen NVA-Reservisten trugen in ihrer Freizeit T-Shirts, auf deren Brust das „Original-Abzeichen“ eines bewaffneten Organs der DDR prangte – mit dem Slogan „TREU GEDIENT“ darunter? Und dann noch eines mit dem Emblem der allseits beliebten „Grenztruppen“?
Selbst wenn es sich um einen Nischenmarkt handeln mag: Studiert man das Angebot von spezialisierten Online-Händlern wie „ossiladen.de“, gewinnt man den Eindruck, dass der Sozialismus sich 2024 einer Produktivität und Nachfrage erfreut, die ihm vor 1989 versagt blieben. Wie viele der damals 2,7 Millionen NVA-Reservisten trugen in ihrer Freizeit T-Shirts, auf deren Brust das „Original-Abzeichen“ eines bewaffneten Organs der DDR prangte – mit dem Slogan „TREU GEDIENT“ darunter? Und dann noch eines mit dem Emblem der allseits beliebten „Grenztruppen“?
Solche Paraphernalia bewarb der Online-Händler „Ossiladen“ neulich in einem Newsletter mit der Behauptung, NVA-Soldaten hätten in „der einzigen deutschen Armee“ gedient, „die nie einen Krieg führte“. Lassen wir diesen Seitenhieb auf die Bundeswehr mal beiseite – er spielt womöglich auf ihre Beteiligung an der völkerrechtlich umstrittenen „Operation Allied Force“ 1999 an – und konzentrieren uns auf die folgende Behauptung: „Die sich weigerte, auf das eigene Volk zu sdc“ (sic!).

Was wollte die Marketing-Fachkraft des VEB „Ossiladen“ hier eigentlich geschrieben haben: „schießen“?
Wie oft die Grenztruppen der DDR den Schießbefehl verweigerten, bezeugen die mindestens 140 (und mutmaßlich viel mehr) Todesopfer allein an der Berliner Mauer …
>> nach oben
Allgemeiner Trend
Veröffentlicht am 17. Oktober 2024
Und wieder lieg ich hier auf meiner Yacht, Dem eitlen, leeren Müßiggang ergeben Und gänzlich ohne Plan und Sinn im Leben, Da hab ich unversehens mir gedacht: Was wohl die Lena Hoschek derzeit macht, Die für ihr unternehmerisches Streben, Die Mode zum Geschäftszweck zu erheben, von mir einst mit Bewunderung bedacht? Was muss ich nun im Internet erfahren? Auch sie folgt einem allgemeinen Trend, Der leider zunimmt in den letzten Jahren Und sichtlich keine Gegenrichtung kennt: Es wankt nun auch das Reich der Modezarin, die Hoschek ist seit kurzem insolvent.
>> nach oben
Immer wieder Österreich!
Veröffentlicht am 1. Oktober 2024
Als ich vor fast 20 Jahren in dieses Land zog, tat ich es unter dem Eindruck, dass in Österreich recht gescheite Leute lebten. Leute, die ihre Traditionen pflegten und zugleich die Chancen ergriffen, die ihnen die europäische Integration und Erweiterung nach Osten boten – also quasi „Laptop und Lederhose“, wie es damals in Bayern hieß, aber ohne das dümmlich Auftrumpfende, das die Bayern allseits so beliebt macht.
Nun, es ist wohl kaum nötig zu sagen, dass sich jener Eindruck als Täuschung erwiesen hat, und nicht erst am vergangenen Sonntag.
Wobei man zur Nationalratswahl 2024 anmerken muss, dass den ca. 6,35 Millionen Wahlberechtigten ab 16 Jahren ca. 1,5 Millionen Menschen gegenüberstehen, die nicht wählen durften, obwohl sie in diesem Land leben und älter als 16 sind. Der Grund: Sie besitzen – wie auch ich – nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.
Österreich hat eines der restriktivsten Staatsbürgerrechte der Welt. Nur Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind da noch strenger. Und die Zahl der hier Ansässigen ohne Wahlrecht wächst, weil die österreichische Gesellschaft wächst, aber eben nur dank Zuwanderung.
Dass das für die Repräsentativität von Wahlergebnissen Probleme aufwirft, liegt auf der Hand: Es relativiert erstens den Machtanspruch einer Partei, die zwar 29 % der Stimmen an Land gezogen hat. Rechnet man aber die freiwilligen und unfreiwilligen Nichtwähler heraus, haben „nur“ 18 % der hier lebenden Menschen im wahlfähigen Alter sie gewählt, oder anders gesagt: 82 % haben die Partei nicht gewählt.
Von einer echten „Volksherrschaft“ kann da kaum die Rede sein.
Geschlossene Gesellschaft
Zweitens verzerrt ein solches Wahlrecht den politischen Wettbewerb, indem es die Blut- und Boden-Parteien begünstigt. Denn die versprechen ja den eh schon Privilegierten noch mehr Vorrechte – oder vielmehr. Sie versprechen ihnen, jene anderen weiter zu entrechten, die schon jetzt weniger Rechte haben als die Einheimischen: die „Fremden“. Etwa durch Abschaffung des Asylrechts oder des Rechts auf Sozialhilfe für Nicht-Österreicher – aber womöglich ist ja auch hier Saudi Arabien das angestrebte Modell.
Jedenfalls spiegelt das Staatsbürgerrecht die Exklusivität der österreichischen Gesellschaft wider und fördert zugleich die völkische Zurichtung der Demokratie.
Das pathologische Ausmaß der hierzulande kultivierten Abneigung gegen „Fremde“ ist mir 2016 bewusst geworden, nach der sogenannten „Flüchtlingskrise“. Als Mitorganisator eines Hilfprojekts für Familien, die aus Syrien und dem Irak geflohen waren, wurde ich zum Adressat von Zuschriften angesehener Mitbürger, die ihrer „Trauer“ über die „Zerstörung“ ihrer „schönen Heimat“ durch „dieses Gesindel“ (d.h. die geflüchteten Familien) zum Ausdruck brachten. Und mir vorwarfen, an dieser Zerstörung mitzuwirken.
Um eins klarzustellen: Als Deutscher, der ökonomisch relativ unabhängig und zudem mit einer Österreicherin verheiratet ist, habe ich hier wenig auszustehen. Uns Deutschen gegenüber pflegen Österreicher ein ganz eigenes Ressentiment, das sich zwar gern trotzig gibt, das dahinter stehende Gefühl der Unterlegenheit lässt sich aber kaum verhehlen. Das macht es natürlich einfacher, sich dagegen zu wehren beziehungsweise Angriffe von vornherein zu vermeiden, indem man das genannte Gefühl beim Gegenüber schont. In letzter Zeit haben auch die Performance der Deutschen Bahn und Fußballnational-Mannschaft der Männer viel dazu beigetragen, das Verhältnis zu verbessern.
Neulich am Neusiedler See
Trotzdem erlebt man immer wieder so Sachen wie vor einiger Zeit am Neusiedler See. Eine Freundin – auch eine Deutsche, die schon lange hier lebt: wir Migrant:innen bilden nunmal gern unsere Parallelgesellschaften – hält sich dort ein kleines Boot, auf dem wir zusammen einen freien Tag genießen wollten. Da der See damals sehr wenig Wasser hatte, verbrachten wir den Tag großteils am Steg, wo die Boote eng an eng benachbart liegen. Neben dem unserer Freundin lag eine größere Yacht, deren Besitzer ebenfalls da war – Altergruppe: junger Pensionist.
Wie es so geht: Man grüßt über die Reling, wechselt ein paar belanglose Worte über das Wetter, den See usw., und dann sagt einem der Nachbar geradewegs ins Gesicht: „Noch mehr Deutsche! Es gibt hier eh schon viel zu viele von euch.“ Dabei stand neben ihm, ohne etwas zu sagen, seine sichtlich jüngere Partnerin. Dass auch sie aus Deutschland stammte, erfuhren wir dann von unserer Freundin.
Später versuchte ich den Mann zu beruhigen. Auch wenn man es an ihrer Sprache nicht höre: Meine Frau sei eigentlich Österreicherin und infolgedessen seien auch unsere Kinder Österreicher. Das hörten andere Nachbarn, die inzwischen dazugekommen waren, Besitzer eines Hauses neben dem Hafen und erkennbar gut situierte Leute. Sie mischten sich ein: Wenigstens seien unsere Kinder blond. „Das können wir hier in Österreich gut gebrauchen.“
>> nach oben
Silbenakrobatik
Veröffentlicht am 24. September 2024
Das Klinggedicht in seiner Formenstrenge, Mit seiner jambisch-fünfhebigen Statik Und seiner Vier- und Drei-Reim-Systematik, Assoziiert man oft mit Zwang und Enge. Doch wenn ich mich in diese Jacke zwänge, Dann tu ich’s, weil mich diese Problematik Reizt, diese Art von Silbenakrobatik, Das Arrangieren formgebundner Klänge. Erstaunlich auch die Vielzahl an Geschichten, Die man erzählen kann in vierzehn Zeilen mit fünf betonten Silben, und mitnichten Ein End in Sicht. So werd auch ich wohl feilen An weiteren Sonetten, Klanggedichten, Und wenn eins glückt, es gern mit andern teilen.
>> nach oben
Wieder an Bord
Veröffentlicht am 29. Juli 2024
Nachdem der alte Tanker „Wissenschaftliche Buchgesellschaft“ im Herbst 2023 an den Klippen der Digitalisierung zerschellt war, drohte auch der Sobresaliente und Gentleman-Passagier Antonio Pigafetta im Strudel der Insolvenz unterzugehen. Was sehr schade gewesen wäre, hat der wackere Globetrotter doch eine Geschichte zu erzählen, die auch nach 500 Jahren nichts von ihrer Frische eingebüßt hat: seinen Bericht von der ersten Umsegelung der Erde 1519-1522.
Doch für alle Pigafetta-Fans und solche, die es noch werden wollen, gibt es gute Nachrichten: Wir konnten für Pigafetta eine neue Passage finden! Der Weltenbummler ist jetzt beim Verlag C.H. Beck an Bord gegangen, der seinen Bericht im Frühjahr 2025 wieder auf die Reise schicken wird. Das freut uns sehr, nicht zuletzt auch deshalb, weil dies die einzige vollständige und authentische deutsche Übersetzung von Pigafettas Reisebericht ist.

Dass die Pigafetta-Ausgabe der Edition Erdmann den Text mutwillig verfälscht, hat sich anscheinend nicht überall herumgesprochen. So bringt das Magazin REPORTAGEN vom Mai 2024 einen als „historische Reportage“ deklarierten Auszug aus der Erdmann-Ausgabe. Da liest man dann wieder Unsinn wie den, dass Magellan seine Truppen vor dem tödlichen Scharmützel auf Mactan mit dem Hinweis auf die kriegerischen Erfolge des Hernán Cortés in Yucatán angefeuert habe – von denen Magellan jedoch weder wusste noch wissen konnte.
Angeblich bringt dieses Magazin „True Stories“ unter die Leute. Die folgenden Behauptungen seiner Redaktion sind jedenfalls nicht in allen Teilen wahr: Magellan sei „1521 auf einen Archipel“ gestoßen: „die Philippinen – so von Magellan nach seinem Financier, dem spanischen König Philipp, benannt“ … Tatsächlich hießen Magellans Geldgeber Karl I. und Cristóbal de Haro, und die Inselgruppe, auf die er am 16. März 1521 stieß, nannte er „Archipel des Heiligen Lazarus“. Ihren Namen „Philippinen“ gab den Inseln gut zwanzig Jahre später Ruy López de Villalobos zu Ehren des damaligen Kronprinzen von Spanien, Philipp II.
Wer glaubt, dass historische Fakten von Bedeutung sind, wird sich daher mit uns freuen, dass Pigafettas Bericht bald wieder in einer wahrhaftigen Übersetzung erhältlich ist. Gut lesen lässt sich diese Übersetzung übrigens auch: Das bezeugen nicht nur viele zufriedene Leser:innen, sondern auch Radio- und Fernsehproduktionen, die sie verwenden.
>> nach oben
Mit der Natur versöhnt
Veröffentlicht am 4. Juni 2024
Eigenes Gemüse zu ziehen, ist ein Sehnsuchtsort vieler Menschen. Die Hände im Humus, den sorgenden Blick zarten Pflänzchen zugewandt, suchen sie nach ihrem beim Geldverdienen abhanden gekommenen inneren Selbst. Und dann wollen sie die Früchte genießen, die Mutter Natur freigiebig denen schenkt, die im Einklang mit ihr tätig sind.
Auch ich habe über Jahrzehnte versucht, dieses grüne Utopia in unserem Garten zu verwirklichen, dafür viel Zeit investiert – und nicht wenig Geld, denn die Produktpalette, die Baumärkte und Discounter für den biologischen Privatanbau anbieten, ist groß. Je größer aber das Investment, desto ärgerlicher natürlich, wenn man um den Ertrag seiner Mühen gebracht wird durch Mitesser, die selbst nicht säen, jedoch umso eifriger ernten. So wie die Nacktschnecken, die (angeblich aus Spanien) ihren Weg auch in unseren Garten gefunden haben.
Dass Arion vulgaris sich bei uns so wohlfühlt, ist einerseits der Lage unseres Gartens am feuchten Grund nahe eines Baches und in der schattigen Nachbarschaft alter Bäume geschuldet. Aber ich leiste seinem evolutionären Erfolg, fürchte ich, noch Vorschub mit meiner liberalen Einstellung gegenüber allem, was wächst. In unserem Garten herrscht ordentlich Wildwuchs, in dem nicht nur das Unkraut, sondern auch die Nacktschnecken gedeihen.
Nun stößt aber naturgemäß jedes „Leben und leben lassen“ da an Grenzen, wo die anderen das Eigene nicht leben lassen – und sei es auch, wie in diesem Fall, nicht das eigene Leben, sondern nur das eigener Gemüsekulturen, auf die sich die unersättlichen Bauchfüßer mit Vorliebe stürzen, solange sie noch jung sind, um sie rest- und rücksichtslos zu vertilgen.

Bild: Foto Reves, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Ob Spinat oder Salat, Erdbeeren oder Erbsen, Kürbis- oder Gurkensetzlinge, Tomaten, Bohnen, ja sogar über Chili- und Kartoffelpflanzen machen sie sich her und lassen von ihnen nichts übrig als glänzende Schleimspuren am Boden.
Wer lässt sich so etwas schon gern gefallen?
Also bin ich zur Bekämpfung der Nacktschnecken aus-, bin ihnen mit Bierfallen und Schneckenkorn zu Leibe gerückt, habe sie wochenlang Abend für Abend im Licht der Stirnlampe eingesammelt, oft genug von Mücken gepeinigt, nicht selten im strömenden Regen, habe alles ausprobiert, die Schädlinge unschädlich zu machen: sie entzwei geschnitten, mit kochendem Wasser übergossen, ins Lagerfeuer geworfen, in Marmeladengläser gefüllt und in der Sonne stehen gelassen, bis sie sich zu einem stinkenden Sud zersetzt hatten … Auch habe ich Eierschalen und Lavagranulat ausgestreut, Schneckenzäune und Hochbeete errichtet in der Hoffnung, die lusitanischen Leckermäuler von meinen Kulturen fernzuhalten, und endlich, des ewigen Kampfes und Tötens müde, sogar Indische Laufenten angeschafft, von denen man sagt, sie seien die größten Fressfeinde der Nacktschnecken.
Doch obwohl wir zeitweilig zehn solcher Enten im Garten hielten, wurden auch sie der Plage nicht Herr, denn so eine Ente frisst vielleicht ein Dutzend Schnecken am Tag (nebst Spinat, Salat und anderen Dingen), im späten Frühjahr jedoch, zur Anbauzeit, fallen die gierigen Gastropoden in Heerscharen zu Tausenden und Abertausenden über unseren Garten her, tummeln sich auf dem Rasen, den Wegen, Komposthaufen und Beeten, kriechen in den Nächten, wenn es abkühlt, die noch warme Hauswand hinauf, ihren Kot hinterlassend, und überziehen die Fenster mit sich kreuzenden Schleimspuren, sodass wir uns zeitweilig wie unter Belagerung fühlen.

Gegen eine solche Invasion können auch ein paar Laufenten nichts ausrichten, und so haben wir, nachdem eines dämmrigen Novembernachmittags mutmaßlich ein Fuchs drei unserer damals noch vier Enten gerissen hatte, die Hinterbliebene einer Nachbarin geschenkt und uns keine neuen mehr angeschafft.
Heute bin ich frei.
Eines Abends, als ich wieder einmal über meinen Beeten hockte, Schnecken einsammelte und sie – weil ich sie schon lange nicht mehr töten mag – kurzerhand über den Zaun auf den brachliegenden Acker nebenan warf, im Wissen, dass die Schnecken von dort wieder in unseren Garten kriechen würden, sodass es eigentlich ein sinnloses Unterfangen war, sie dorthin zu werfen, aber ich dachte, auf diese Weise gewönnen meine Pflänzchen etwas Zeit, die ihnen – oder wenigstens einigen von ihnen – vielleicht so gerade eben erlauben würde, über die kritische Phase des Keimens hinauszuwachsen – während ich also dort hockte und Nacktschnecken aufklaubte, erkannte ich, dass diese schleimigen Tiere nicht viel anders sind als wir Menschen, oder besser gesagt: wir Menschen nicht anders als sie.
Auch wir fallen über diesen Planeten her, haben keine Fressfeinde mehr, sind unersättlich, wollen immer nur das Beste für uns, und der ökologische Fußabdruck, den wir hinterlassen, ist noch viel schlimmer als die Schleimspuren der Bauchfüßer.
Ich erkannte: Die Nacktschnecke ist unser Alter Ego und sie ist unsere Nemesis. Und in dem Augenblick beschloss ich aufzugeben, den Gemüseanbau für immer sein und den Garten den Schnecken zu überlassen. Seither geht es mir besser. Seither bin ich mit der Natur versöhnt, und mein Gemüse kaufe ich im Supermarkt.
>> nach oben
Pigafetta im Radio
Veröffentlicht am 9. Mai 2024
Liebe Listeners,
gestern Abend war der wackere Pigafetta wieder mal im Radio zu hören (in meiner Übersetzung):
(Audiofile nicht mehr online [29.07.24])
>> nach oben
Alle Räder stehen still, wenn der böse Marder will
Veröffentlicht am 8. Mai 2024
„Am Land geht es nicht ohne Auto“, heißt es oft. Sagen wir mal so: Es ginge schon, jedenfalls wenn man wie wir in einem Ort wohnt, wo einmal in der Stunde die Schnellbahn hält. Aber man müsste sein Leben natürlich ganz anders organisieren und für viele Wege, Einkäufe, Arztbesuche, Familienausflüge usw. deutlich mehr Zeit einplanen, die einem dann wohl für andere Dinge abgehen würde. Darum haben auch wir ein Auto.
Was bei solchen Aussagen gern unter den Tisch fällt: Auch am Land kann man ein Auto so oder so nutzen. Man kann sein Auto etwa für kürzere Wege stehen lassen und stattdessen aufs Rad steigen oder, um die Kinder von der Musikschule oder vom Sport abzuholen, Fahrgemeinschaften bilden und natürlich versuchen, umweltschonender zu fahren, das heißt langsamer.
Um es gleich zu sagen: In unserem ländlichen Umfeld sind solche Verhaltensweisen ein Minderheitenprogramm.
Oder wie mein Großvater es ausgedrückt hätte: „Geht nicht heißt will ich nicht.“

Bild: Kolektyw Kariatyda, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Wie gesagt, auch wir haben ein Auto. Beziehungsweise, zur Zeit haben wir keines mehr, weil ein Marder sich im Motorraum ausgetobt und unter anderem – unser Auto ist ein Hybrid – das Hochvoltkabel zerbissen hat, das die Batterie mit dem Motor verbindet. Dieses Kabel zu ersetzen, kostet nicht nur eine mittlere vierstellige Summe, sondern es braucht auch fünf bis sechs Wochen, es zu liefern, sagt unsere Autowerkstatt. Das gibt uns jetzt reichlich Gelegenheit, die obige Aussage – „Ohne Auto geht es nicht.“ – auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen.
Derartige Angriffe auf unseren Lebensstil sind natürlich nicht geeignet, unsere positive Einstellung zur Natur zu fördern – abgesehen davon, dass sie geradezu nach Verschwörungstheorien schreien!
Mein erster Gedanke war, dass militante Klimaschützer den Marder abgerichtet haben müssen, um möglichst viele Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Aber hätte der vierbeinige Kabelterrorist dann nicht eher die SUVs, Pickups und vorsintflutlichen Stinkediesel attackieren sollen, die zahlreich in unserer Nachbarschaft herumstehen, und nicht unseren vergleichsweise sparsamen Hybrid?
Doch dann ging mir ein Licht auf: Nicht die Klimaschützer hatten den Marder abgerichtet und auf Hybridkabeljagd geschickt, sondern dahinter muss die Verbrenner-Lobby stecken, wahrscheinlich im Verein mit den Geheimdiensten erdölfördernder Schurkenstaaten. Sie senden jetzt sogar Tiere aus, um gezielt Hybrid- und Elektroautos zu attackieren, damit die Besitzer:innen wieder auf reine Verbrenner umsteigen. Was für eine perfide Strategie!
>> nach oben
Sammlerstück
Veröffentlicht am 12. April 2024
Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass eines meiner Bücher noch zu meinen Lebzeiten als Rarität und Sammlerstück gehandelt wird …
Wie berichtet, ist meine Pigafetta-Übersetzung seit kurzem vergriffen und eine Neuauflage nicht in Sicht, weil ich für diesen wunderbaren Reisebericht aus der Frühen Neuzeit nach der Insolvenz der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erst wieder einen Verlag finden muss. Das werde ich hoffentlich rasch, denn aktuell wird im antiquarischen Handel nur mehr ein einziges Exemplar meiner Übersetzung für sage und schreibe 169,99 Euro angeboten.
Man könnte meinen, der Preis sei nicht übertrieben, handelt es sich doch um die bislang einzige Übersetzung aus erster Hand ins Deutsche[1] und um die einzige, die nicht nur den vollständigen Text, sondern auch die 23 farbigen Miniaturen bietet, die der Autor dem Text mitgegeben hat.
Allerdings hätte es Pigafettas Bericht verdient, für ein größeres Publikum erschwinglich zu sein. Daher hoffe ich sehr, dass sich bald ein Verlag für eine Neuausgabe findet – Interessenten bitte melden!
- [1] Christian Jostmann, Pigafetta als Pulp Fiction. Eine Fallstudie in provinzieller Aneignung, in: Archiv für Kulturgeschichte. Band 105,2 (2023), S. 405–432.
>> nach oben
Verbrenner
Veröffentlicht am 2. April 2024
In lauen Nächten, wie sie uns betören Zu dieser Jahreszeit schon viel zu früh, Da hat ein Dorfbewohner seine Müh Infolge des Verhaltens dummer Gören, Die seinen Wunsch nach Ruhe nächtlich stören, Indem zu vorgerückter Stunde sie Mit Aufwand von fossiler Energie Auf ihren Mopeds durch die Straßen röhren. Die Jugend auf dem Dorf will’s nicht kapieren, Weil ihr’s anscheinend an Verstand gebricht. Solln andre doch am Freitag demonstrieren Fürs Klima, üben den Konsumverzicht. Sie wollen sich zu Tode amüsieren, Und dass die Erde brennt, verstört sie nicht.
>> nach oben
Usern von Online-Foren zur Warnung
Veröffentlicht am 20. März 2024
In Online-Foren treffen sich die Leute, Um über alles Mögliche zu reden. Die Diskussionen richten sich an jeden, Der keine Scheu hat vor dem Hass der Meute. Denn eh man sich versieht, wird man zur Beute Von fiesen Trollen, die verbiss’ne Fehden Im Netz austragen; sich in ihre blöden Debatten eingemischt zu haben, reute So manchen ahnungslosen User schon. Was mich an vielen Postings abstößt, ist, Vom Inhalt einmal abgesehn, der Ton. Auch fragt man sich, ob manchen für den Mist, Den sie da posten, zahlt wer einen Lohn. So ist, was man in Foren liest, oft trist.
>> nach oben
Kriegsversehrt
Veröffentlicht am 23. Februar 2024
Als der Krieg in seinen ersten Winter ging, war mir klar, dass wir nicht tatenlos bleiben konnten, dass auch wir unseren Beitrag leisten mussten, damit nicht der Aggressor triumphierte. Mich selbst zur kämpfenden Truppe zu melden, kam nicht in Frage, schon meines Alters wegen nicht, vor allem aber, weil ich in meiner Jugend keine soldatische Ausbildung genossen habe (obwohl der Staat sie mir seinerzeit kostenlos zur Verfügung gestellt hätte). Unerfahren, untrainiert und von Natur aus ängstlich wäre ich den Verteidigern mehr Last als Hilfe gewesen. Doch ich wusste, was ich stattdessen tun konnte, um den Angegriffenen beizustehen …
[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]
Wie so viele Menschen in unserem Land heizen auch wir unser Haus mit Gas, und zwar mit Gas, das großteils aus Russland kommt. Ein gutes Gefühl hatte ich dabei nie, aber mit Hilfe opportunistischer Erwägungen war es mir über die Jahre immer wieder gelungen, mein Unbehagen zu verdrängen. Seit dem 24. Februar 2022 ist das jedoch nicht mehr möglich.
Nach dem Schock des Angriffs hatten wir für unser Haus gleich einen zweiten Kaminofen und eine große Fuhre Holz bestellt – keineswegs voreilig, wie sich zeigte, denn die Nachfrage nach Öfen und Brennholz schoss bald durch die Decke. Wir aber besaßen nun zwei Öfen, einen im Alt- und einen im Anbau, die leistungsstark genug waren, um zumindest die zentralen Räume des Hauses zu erwärmen, sowie einen stattlichen Vorrat an Brennstoff. Damit fühlten wir uns weniger erpressbar. Selbst wenn es hart auf hart käme, würden wir im Winter auch ohne Gas nicht frieren müssen.
Doch allen Drohungen zum Trotz strömte das Gas weiter in unser Land und in unser Haus, und das war auch kein Wunder, finanzierte der Aggressor doch mit dem Gas seinen mörderischen Krieg, der nicht nur die Existenz der attackierten Ukraine, sondern unser aller Frieden und Freiheit bedrohte. Umso mehr galt es, seine Einnahmen aus diesem Geschäft, so weit es irgend ging, zu drosseln. Und hier kamen unsere Öfen ins Spiel.
Wer je mit einem Zimmerofen für Festbrennstoffe geheizt hat, weiß, dass das zwar romantisch, aber mit Arbeit verbunden ist. Brennholz muss beschafft, eingelagert, auf handliche Größe geschnitten und portionsweise ins Haus geschafft werden. Man muss den Ofen jeden Tag erst an- und dann auf Betriebstemperatur hinaufheizen, später drosseln und entsprechend des Bedarfs regulieren, das heißt immer wieder nachlegen und die Luftzufuhr justieren. Dabei sollte man den Ofen entweder im Auge behalten oder mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, wann man nachlegen muss; tut man es zu spät, ist er nur mit Mühe wieder auf Touren zu bringen. Dabei ist nicht nur jeder Ofen anders, sondern der Verbrauch schwankt auch je nach Qualität des Brennolzes, Außentemperatur, Windstärke, Windrichtung usw.
Am nächsten Tag muss der Ofen gesäubert, die Asche mit einem Handfeger ausgekehrt und außer Haus gebracht werden. Ist der Ofen, wie unsere es sind, mit Scheiben ausgestattet, so sind diese periodisch – je nach Geschick beim Anheizen – zu reinigen, am besten mittels Zeitungspapier, Wasser und Asche. Auch der Boden um den Ofen wird laufend schmutzig durch Dreck, den man mit dem Holz ins Haus trägt, und herauswirbelnde Asche. (Über den Feinstaub, der bei der Verbrennung anfällt, macht man sich am besten gar nicht erst Gedanken.) Je nach Empfindlichkeit wird man mithin auch untertags immer wieder Kehrschaufel und Besen oder den Wischeimer zur Hand nehmen.
Aber da hat der tägliche Ablauf längst von vorn begonnen: Holz ins Haus schaffen, den Ofen anheizen, aufheizen, nachschauen, nachlegen, Holz nachholen, bis am nächsten Morgen wieder das Auskehren der Asche ansteht, und so geht es fort, Tag um Tag, Woche für Woche, den ganzen Winter. Man trage im übrigen keine helle Kleidung, denn es ist fast unvermeidlich, dass man sich entweder beim Einheizen oder Säubern mit Ruß beschmutzt, und vergesse nicht das Händewaschen, sofern man keine Handschuhe trägt, sonst zieren Rußflecken vor allem Türen, Zargen und Lichtschalter.
Mit zwei Öfen hatte ich diese Arbeit nun doppelt, wobei der neue Ofen, den wir in unsere Wohnküche gestellt hatten, eher klein war und deswegen sehr oft bestückt werden musste. Schnell sah ich ein, dass ich ihn kaum den ganzen Tag am Laufen halten konnte. Stattdessen ging ich dazu über, ihn immer erst abends einzuheizen, wenn sich die ganze Familie wie in der guten alten Zeit in der Küche versammelte; denn in den anderen Räumen, Schlaf- und Kinderzimmern, war es, solange die Gasheizung nicht ansprang, ziemlich kühl. Dass die Heizung ansprang, versuchte ich aber tunlichst zu vermeiden, indem ich die Öfen, wann immer es ging, in Betrieb nahm, tagsüber den in meinem Arbeitszimmer, der, moderate Kälte vorausgesetzt, das gesamte Untergeschoß des Altbaus mit Wärme versorgte, und abends wie gesagt das Öfchen im Anbau, in unserer Wohnküche. Da sich dort auch der Thermostat für die Zentralheizung befindet und der Anbau besser (bzw. überhaupt) gedämmt ist, reichte die in der Küche gespeicherte Wärme hin, dass die Gasheizung sich für viele Stunden, manchmal bis zum nächsten Morgen nicht mehr einschaltete.
So gelang es mir durch konsequentes Heizen beider Öfen unseren Gasverbrauch in jenem Winter auf weniger als ein Drittel des Vorkriegsniveaus zu senken, von ca. 1450 auf 470 Kubikmeter im Jahr – und das obwohl mich vor Weihnachten eine Grippe für zwei Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, ausgerechnet während der ersten Kältewelle jenes Winters, sodass die Gasheizung in dieser Zeit permanent lief. Dennoch befand ich am Ende des Winters, dass ich alles in allem zufrieden sein konnte mit dem Resultat meiner Anstrengungen, ja ich sah sogar ein wenig optimistischer in die Zukunft, auch wenn ich spürte, dass mein Einsatz an der Heizfront einen Preis hatte, den ich womöglich noch länger abbezahlen würde.
Irgendwann im Lauf des Winters bemerkte ich einen Schmerz zunächst im linken Ellenbogen, der immer dann auftrat, wenn ich ein Holzscheit nahm und in den Ofen legte. Mit der Zeit verstetigte sich dieser Schmerz. Er trat auch bei anderen Tätigkeiten auf, strahlte in Ober- und Unterarm aus und wurde irgendwann so penetrant, dass ich fast jede Nacht aufwachte, weil mein linker Arm so sehr schmerzte. Ich versuchte den Arm zu entlasten, ohne jedoch meinen Ehrgeiz beim Heizen zu drosseln, indem ich mehr auf den rechten Arm zurückgriff. Außerdem machte ich täglich Dehn- und Lockerungsübungen, die ich mir auf Youtube angesehen hatte. Ich will nicht sagen, dass diese Maßnahmen sinnlos waren, aber sie bewirkten nicht nur keinen merklichen Rückgang der Beschwerden, sondern gegen Ende des Winters begann auch der rechte Arm vom Ellenbogen ausgehend zu schmerzen. Schließlich suchte ich eine orthopädische Praxis auf.
Tennisellenbogen hieß die Diagnose. Die Orthopäden empfahlen mir, abends Ibuprofen und Novalgin zu nehmen, um besser zu schlafen, verpassten mir Injektionen und, als diese nicht halfen, hochenergetische Stoßwellen und Ergotherapie. Unterdessen wurde es erneut Herbst, und der Krieg in der Ukraine ging weiter, ohne dass die angekündigte Sommeroffensive, wie erhofft, das Blatt zugunsten der Verteidiger gewendet hatte. Im Gegenteil, der Aggressor schien immer mehr die Oberhand zu gewinnen.
Man müsse Geduld haben, sagten die Orthopäden. Die heilende Wirkung der Stoßwellen zeige sich erst nach mehreren Wochen. Als ich ihnen zwei Monate später berichten musste, dass der linke Arm seit der Behandlung sogar mehr weh tat als vorher und zehn Einheiten Ergotherapie auch nur wenig bewirkt hatten, waren sie kurz ratlos. Nun verordneten sie mir neue Behandlungen: Galvanisation, Iontophorese und Ultraschalltherapie. Doch nach drei Sitzungen schmiss ich die Flinte ins Korn, weil ich abermals keinerlei Verbesserung spürte. Mittlerweile war der Krieg in seinen zweiten Winter eingetreten.
Während sich der zweite Jahrestag der Invasion nähert, lese ich Tag für Tag von Drohnenangriffen auf die Ukraine, von der schwierigen Lage an der Front, vom langsamen, wenn auch für sie verlustreichen Vorrücken der Angreifer, und Tag für Tag befeuere ich weiterhin meine Öfen mit Holzscheiten, auch wenn meine Arme schmerzen und ich im Grunde weiß, dass mein Einsatz am Ende wohl keinen Unterschied machen wird. Aber von den Orthopäden erwarte ich auch nicht mehr viel.
[/read]
>> nach oben
Die Remigration der Mauren
Veröffentlicht am 29. Januar 2024
Die Idee, dass sich gesellschaftliche Probleme durch massenhafte Vertreibung von Menschen lösen ließen, ist alles andere als neu. Als sich Anfang des 17. Jahrhunderts im Königreich Spanien die Anzeichen einer politischen und wirtschaftlichen Krise häuften, wurden Stimmen immer lauter, die die Vertreibung der „Moriscos“ forderten. Die Nachkommen der ehemals muslimischen Bevölkerung Spaniens seien schuld am allgemeinen Niedergang, hieß es. Sie müssten daher kollektiv des Landes verwiesen werden, sonst sei Spanien nicht mehr zu retten. Also unterschrieb König Philipp III. im September 1609 das Dekret der Ausweisung …
[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]
Die katholische Kirche hat ihn 1960 zur Ehre der Altäre erhoben: Juan de Ribera, an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert Erzbischof von Valencia. Er war ein gebildeter Mann, ein Vorkämpfer der Gegenreformation, und sein Einfluss reichte weit über die Grenzen seiner Diözese hinaus. Als Erzbischof hatte Juan de Ribera sich nicht zuletzt mit dem Problem der „Moriscos“ auseinanderzusetzen.

Bild: Wikimedia Commons
Moriscos, „kleine Mauren“, nannte man damals in Spanien die Nachfahren der Muslime, die einst auf der iberischen Halbinsel heimisch gewesen, aber nach ihrer vollständigen Eroberung durch christliche Herrscher gezwungen worden waren, sich taufen zu lassen. Die Moriscos lebten in eigenen Wohnbezirken, unterschieden sich durch Kleidung und Brauchtum, manche auch durch ihre Sprache von der Mehrheit der „alten“ Christen, und standen allgemein im Verdacht, weiter dem Islam anzuhängen.
Im Dezember 1601 adressierte Juan de Ribera ein Memorandum an König Philipp III., in dem er seine jahrzehntelangen Anstrengungen, die Moriscos durch Katechese zu guten Katholiken zu machen, für gescheitert erklärte. Die Moriscos, klagte der Erzbischof, seien noch immer „Mauren, die der mohammedanischen Sekte angehören, die Vorschriften des Korans befolgen und die heiligen Gesetze der Katholischen Kirche missachten“. Schlimmer noch, die Moriscos stünden mit den Feinden Spaniens, allen voran den Türken, im Bunde. Auch am wirtschaftlichen Niedergang des Landes trügen sie Schuld und am Banditentum, welches im Königreich Valencia derartige Auswüchse angenommen habe, „dass Alt-Christen, die in Morisco-Gegenden leben, sich nachts nicht mehr vor die Tür wagen“. Die Moriscos seien wie „verwachsene Bäume, voller Knoten der Häresie“, die man am besten samt den Wurzeln herausrisse. Es gebe keine Alternative: Die Moriscos müssten des Landes verwiesen werden, schloss der knapp siebzigjährige Juan de Ribera, „oder ich werde zu meinen Lebzeiten den Untergang Spaniens mitansehen“.
Im Königreich Valencia zählten die Moriscos damals etwa 130.000 Seelen, rund ein Drittel der Bevölkerung. In allen spanischen Reichen auf der iberischen Halbinsel schätzt man ihre Zahl auf ca. 300.000, bei einer Gesamtpopulation von vielleicht 7 oder 8 Millionen. So viele Menschen auszuweisen, war eine drastische Forderung, egal ob man sie vom Standpunkt der Betroffenen betrachtete oder von dem des Staates, der diesen Massenexodus organisieren sollte. Andererseits machten die Moriscos in Summe nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung aus. Wie konnte diese Minderheit einen Kirchenfürsten wie Juan de Ribera derart in Verzweiflung treiben, dass er glaubte, nur ihre Ausweisung könne Spanien noch retten?
Dass Muslime – und ehemalige Muslime – unter christlicher Herrschaft lebten, war an sich nichts Neues. Im Gegenteil, auf der iberischen Halbinsel war es trotz „Reconquista“ jahrhundertelang der Normalfall gewesen, so wie auch muslimische Herrscher christliche Untertanen tolerierten. Die Kunst Andalusiens kündet noch heute von dieser „Convivencia“, dem Zusammenleben der Religionen im Mittelalter, auch wenn man sich dieses Zusammenleben nicht allzu idyllisch ausmalen sollte. Aber wenn es auch prekär war und immer wieder von Phasen des Krieges unterbrochen wurde – es funktionierte, über Jahrhunderte hinweg.
Erst als die Katholischen Könige Ferdinand und Isabella ihre Reiche vereinten und das Emirat Granada, die letzte muslimische Hochburg auf der Halbinsel, eroberten, also erst mit der Gründung des modernen spanischen Staates setzte sich die Idee durch, dass dessen Untertanen alle dieselbe katholische Religion ausüben sollen. Um diese Idee zu verwirklichen, führten die Monarchen 1478 die Inquisition ein, 1492 ließen sie die Juden ausweisen und 1502 zwangen sie die Muslime Granadas, sich taufen zu lassen oder das Land zu verlassen. Im Jahr 1526 – da herrschte bereits Kaiser Karl V. über Spanien – erging dieselbe Forderung an die Muslime in Valencia und Aragón, die dem Kaiser jedoch für viel Geld das Zugeständnis abkauften, eine gewisse Zeit an ihren Bräuchen festhalten zu dürfen. So entstand das Morisco-Problem einer nicht assimilierten, von der christlichen Mehrheitsgesellschaft misstrauisch beäugten Minderheit.
Freilich war diese Minderheit höchst heterogen. Während in entlegenen Gebirgsregionen wie den Alpujarras viele Moriscos tatsächlich der Religion ihrer Vorfahren treu blieben, nahmen andere das ihnen aufgezwungene Christentum an. Gemeinsam war jedoch allen, dass sie den unteren Schichten der Gesellschaft angehörten. Die meisten Adligen und Reichen unter ihnen, vor die Wahl gestellt zwischen Zwangstaufe und Emigration, hatten Spanien den Rücken gekehrt.
Auch die Einstellung der Alt-Christen zu den Moriscos war alles andere als einheitlich. Der Hochadel des Königreichs Valencia, dessen Ländereien vorwiegend von Moriscos bewirtschaftet wurden, wollte von der Ausweisung dieser wertvollen Arbeitskräfte nichts wissen. Auch in der Kirche gab es moderate Stimmen, die um Geduld mit den „neuen“ Christen warben. Doch je mehr das 16. Jahrhundert voranschritt, desto schriller klang der Diskurs. Die Moriscos wurden zunehmend als bedrohlicher Fremdkörper wahrgenommen. Sie vermehrten sich rascher als die Alt-Christen, hieß es, und bildeten eine fünfte Kolonne im Hinterland, die mit den zahlreichen Feinden Spaniens paktiere.
Da sie von vielen Berufen ausgeschlossen waren, war es kein Wunder, dass immer mehr Moriscos sich zum Lebensunterhalt auf den Straßenraub verlegten – insofern waren die Klagen des Erzbischofs nicht unbegründet. Gegner des valenzianischen Hochadels befürworteten die Ausweisung, weil sie hofften, diesem damit die Existenzgrundlage zu entziehen. Und im Ausland mehrten sich Stimmen, die Spaniens Selbstbild als Bollwerk des Katholizismus infrage stellten, weil es im Land so viele Ungläubige dulde. Militärische Desaster wie die Armada von 1588 gegen England und eine Reihe von Staatsbankrotten bestärkten so manchen im Gefühl, dass es mit dem spanischen Weltreich bergab ging – und dass die Ausweisung der Moriscos die einzige Rettung wäre. Juan de Ribera war nicht einmal der Extremste unter ihnen. Ein anderer Bischof schlug vor, die Moriscos zu kastrieren und nach Neufundland zu deportieren, wo sie ein gnädiger Tod ereilen mochte.

Bild: Wikimedia Commons
Nach jahrelangen Diskussionen ließ König Philipp III. im September 1609 das Dekret der Ausweisung verkünden – vielmehr der Vertreibung, denn viele Moriscos weigerten sich, ihre Heimat zu verlassen. Sie verschanzten sich in den Bergen, und der spanische Staat ließ tausende Soldaten aufmarschieren, die an den Widerstrebenden – Männern, Frauen und Kindern – Massaker verübten und sie an die Küsten trieben, wo schon die Galeeren warteten. Kinder wurden ihren Eltern entrissen und katholischen Familien zugewiesen. Viele Moriscos zogen der Vertreibung den Selbstmord vor, andere wurden Opfer des Meeres oder von Korsaren. Jene aber, die Nordafrika erreichten, erwartete kaum ein besseres Schicksal. Sie fielen Banditen in die Hände, die sie ausplünderten, vergewaltigten, ermordeten, und verhungerten zu Tausenden.
Als die spanische Krone die Vertreibung nach fünf Jahren für vollzogen erklärte, waren weite Landstriche entvölkert, war der ökonomische Schaden vor allem in den Königreichen Valencia und Aragón immens. Juan de Ribera hat diesen Moment nicht mehr erlebt. Er starb 1611. So blieb es ihm erspart, den Niedergang Spaniens mitanzusehen. Mit dem Weltreich ging es weiter bergab – auch nachdem die Sündenböcke vertrieben waren.
Dieser Text erschien erstmals am 22. April 2019 in der Furche.
[/read]
>> nach oben
Verraten und verkauft
Veröffentlicht am 15. Januar 2024
Eigentlich hätte ich mich freuen können: In der vergangenen Woche standen zwei meiner Bücher bei Amazon auf der Bestseller-Liste. Vor allem meine Pigafetta-Übersetzung war einmal mehr stark nachgefragt, was mit der vierteiligen Magellan-Doku zusammenhängen dürfte, die derzeit auf Arte läuft. Die Doku ist mit langen Passagen aus Pigafettas Reisebericht unterlegt, und für die deutsche Synchronfassung haben sich die Produzenten meiner Edition bedient.
Ein Anlass zur Freude für den Autor und Übersetzer, sollte man meinen. Bloß ist meine Übersetzung leider in der „wbg“ erschienen. Hinter dem Kürzel steht die „Wissenschaftliche Buchgesellschaft“, die eigentlich dieser Tage ihr 75jähriges Bestehen feiern wollte. Doch stattdessen musste die „wbg“ zum 1. Januar Insolvenz anmelden, nachdem sie bereits im Oktober wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen entsprechenden Antrag gestellt hatte.
Inzwischen steht fest, dass die „wbg“ abgewickelt wird – ein harter Schlag für die deutsche Wissenschaftskultur wie auch für die 65 Mitarbeiter der wbg, von denen die meisten wohl nicht persönlich für die Pleite verantwortlich sind. Ein harter Schlag aber auch für einen, der als freier Autor vom Verkauf seiner Texte und Bücher lebt. Ist doch mehr als fraglich, ob ich von den Honoraren, die mir die „wbg“ seit Mitte 2022 schuldig ist, auch nur einen Teil bekommen werde.
Schmerzlicher finde ich jedoch, dass die Nutzungsrechte an meiner Pigafetta-Übersetzung beim insolventen Verlag verbleiben, das heißt bei der Insolvenzverwalterin, die anscheinend versucht, die Rechte zu veräußern, um noch etwas Geld für die Gläubiger herauszuschinden – wie altes Büromobiliar, das bei einer Zwangsversteigerung verhökert wird. Dass ich von dem Erlös wohl keinen Cent sehen werde, ist noch das kleinere Übel. Ärger ist, dass ich keinen Einfluss darauf habe, in wessen Hände die Nutzungsrechte an meinem Werk geraten werden. Vor allem aber ist völlig offen, wann die Übersetzung wieder lieferbar sein wird.
Dies ist umso beklagenswerter, als es sich hierbei um die erste handelt, die Pigafettas Text direkt aus der Originalsprache und vollständig ins Deutsche überträgt: die erste seit ziemlich genau 500 Jahren, seit Pigafetta seinen Bericht abgefasst hat. Alle bisherigen deutschen Ausgaben waren Übertragungen aus zweiter oder dritter Hand; zwei sind sogar Plagiate, und die von Robert Grün in der Edition Erdmann ist teils eine bewusste Fälschung. Das habe ich jüngst in einem Beitrag für das „Archiv für Kulturgeschichte“ nachgewiesen. (S.a. hier: So grün, wenn Spaniens Blüten.)
Umso mehr hoffe ich, dass die Nutzungsrechte an meiner Pigafetta- Übersetzung an jemanden geraten, die (oder der) den Wert dieses großartigen Textes zu schätzen weiß und ihn dem deutschsprachigen Publikum bald wieder verfügbar macht!
Update vom 20. März 2024:
Die Insolvenzverwalterin hat mittlerweile erklärt, den Verlagsvertrag, den ich mit der wbg über die Veröffentlichung der Pigafetta-Übersetzung geschlossen hatte, gemäß §103 InsO nicht erfüllen zu wollen.
Damit sind die Nutzungsrechte an mich als Urheber zurückgefallen, und ich kann selbst entscheiden, an wen ich die Rechte zur Neuveröffentlichung vergebe.
Sia ringraziato Dio!
>> nach oben
Mein Lieblingsfest (Tribute to Christoph & Lollo)
Veröffentlicht am 16. Dezember 2023
Von allen Festen, die im Jahreskreis Sich aneinanderreihn, gefällt den meisten Wohl Weihnachten am besten, und sie leisten Zur Feier dieses Tages sich was weiß Denn ich für Sachen, kaufen jeden Scheiß, Um welchen ihre Wünsche ständig kreisten, Verwöhnen ihre Mägen mit sehr feisten Genüssen. Dabei scheu’n sie keinen Preis. Was mich betrifft, so schätz’ von allen Festen Das Weihnachtsfest ich beinah am geringsten. Ich will mich nicht wie einen Truthahn mästen Und die Geschenke lass ich gern den Jüngsten. Deswegen finde ich am allerbesten Ein anderes: Mein Lieblingsfest heißt Pfingsten!
>> nach oben
Die vielen Leben des Oscar Koelliker
Eine Spurensuche in der Schweiz
Veröffentlicht am 16. November 2023
 Zugegeben, es ist keine weltbewegende Frage, aber ich interessiere mich nun mal für die Menschen, deren Bücher ich lese, und noch mehr, wenn ihre Biographien vom Schleier des Rätselhaften umgeben sind. So habe ich mich schon oft gefragt, wer eigentlich Oscar Koelliker war. Koelliker hat vor mehr als hundert Jahren ein dickes Buch veröffentlicht: „Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22 dargestellt nach den Quellen“ (Piper Verlag, München 1908). Dieses Werk aufzuschlagen, lohnt noch immer, nicht nur weil es prächtig ausgestattet ist mit Karten und Bildern, sondern auch weil es viele historische Quellen zu Magellans Expedition in deutscher Übersetzung bietet.
Zugegeben, es ist keine weltbewegende Frage, aber ich interessiere mich nun mal für die Menschen, deren Bücher ich lese, und noch mehr, wenn ihre Biographien vom Schleier des Rätselhaften umgeben sind. So habe ich mich schon oft gefragt, wer eigentlich Oscar Koelliker war. Koelliker hat vor mehr als hundert Jahren ein dickes Buch veröffentlicht: „Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22 dargestellt nach den Quellen“ (Piper Verlag, München 1908). Dieses Werk aufzuschlagen, lohnt noch immer, nicht nur weil es prächtig ausgestattet ist mit Karten und Bildern, sondern auch weil es viele historische Quellen zu Magellans Expedition in deutscher Übersetzung bietet.
Man möchte daher meinen, der Verfasser sei Geograph oder Historiker von Beruf gewesen. Das ist jedoch kaum wahrscheinlich …
[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]
Denn wäre Oscar Koelliker berufsmäßiger Wissenschaftler gewesen, hätte er wohl mehr einschlägige Publikationen hinterlassen als dieses eine Buch. Nur ein weiteres Mal noch tritt er kurz in Erscheinung als Mitarbeiter von „Petermanns Geographischen Mitteilungen“. Für den 58. Band dieser traditionsreichen Zeitschrift trug er 1912 zwei Rezensionen und eine Miszelle bei, die alle um dasselbe Thema kreisen wie das Buch: die Erdumsegelung Magellans und Elcanos. Im Mitarbeiterverzeichnis von Petermanns Mitteilungen ist der Autor als „Koelliker, Oskar [sic!], Thalwil-Zürich“ aufgeführt, ohne akademischen Titel oder Berufsbezeichnung.
Oscar bzw. Oskar Koelliker scheint also ein echter „homo unius libri“ gewesen zu sein: ein Mann, der nicht mehr (aber auch nicht weniger) als ein Buch geschrieben hat. In dessen Vorwort steht denn auch alles, was wir sicher über ihn wissen: dass der Verfasser im Frühjahr 1908 in Thalwil bei Zürich lebte (oder weilte) und dass er sich viele Jahre „in Spanien, Portugal, Italien, Nord- und Südamerika“ aufgehalten hatte, „wo sich“ ihm, wie er schrieb, „die Gelegenheit bot, die einschlägige Literatur“ zur Magellan-Expedition „in den Urtexten zu studieren und zu sammeln“. Das war‘s.
Thalwil (früher auch Thalweil geschrieben) liegt am linken Ufer des Zürichsees. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich das Bauerndorf in eine boomende Kleinstadt verwandelt. Bevölkerung und Wohlstand wuchsen rasant, vor allem dank einer florierenden Textilindustrie und einer Bahnlinie in die nur wenige Kilometer entfernte Kantonshauptstadt.

Bild: Wikimedia Commons
Der Nachname „Kölliker“ war hier seit alters geläufig, die Kombination mit dem Vornamen „Oscar“ jedoch eher selten. Und noch seltener, wenn der Träger 1908 alt genug gewesen sein soll, um dicke Bücher zu schreiben. Einen Kandidaten, der diese Voraussetzung erfüllt, hat Karl-Heinz Wionzek dingfest gemacht[1]: einen 1868 in Horgen bei Zürich geborenen Künstler, der Ende des 19. Jahrhunderts nach St. Petersburg auswanderte und sich 1907 in Frankreich niederließ, zunächst in Asnières (sur-Seine) und ab 1914 in Paris. Er ist in J.P. Zwickys „Genealogie der Familien Kölliker“[2] (unter Nr. 185) als „Oskar Kölliker … Bürger von Thalwil“ aufgeführt und in Thieme-Beckers „Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler“[3] als „Oscar Koelliker“, hier allerdings mit Geburtsort Neuchâtel.
Der Maler Oscar Koelliker/Oskar Kölliker nahm seinerzeit an großen Ausstellungen teil, so etwa 1907, 1910 und 1912 in den Salons der Société des Artistes Indépendants, der Société des Artistes Français 1908 und 1914 sowie in weiteren, in Frankreich und der Schweiz. Am 9. September 1941 vermeldeten die „Nouvelles de Versailles“ sein Ableben im Alter von 72 Jahren[4]. Im Internet findet man einige seiner Werke, durchweg kleinformatige Landschaften in Öl, im Stil des Impressionismus, die offenbar auch heute noch ihre Käufer finden.
Doch wie wahrscheinlich ist, dass ein Künstler, der 1907 und 1908 in Pariser Salons ausstellte, und der Verfasser eines geographisch-historischen Sachbuchs, das 1908 in München erschien, identisch sind? Wenn sie es wären: Warum findet sich dann im Buch keinerlei Verweis auf die künstlerische Tätigkeit des Autors? Müssten nicht stilistische Bezüge zwischen Buch und Malerei erkennbar sein? Warum unterschreibt Kölliker das Vorwort seines Buches mit „Thalwil-Zürich, im Frühjahr 1908“, wenn er zu diesem Zeitpunkt in Asnières lebte und nicht einmal in Thalwil geboren war? Warum findet sich auch im Mitarbeiterverzeichnis von Petermanns Geographischen Mitteilungen wieder nur die Angabe „Thalwil-Zürich“? Wie wahrscheinlich ist zuletzt, dass ein Maler ausgerechnet zu derselben Zeit, da er seinen künstlerischen Durchbruch feiert, eine nicht minder beachtliche Fleißarbeit auf dem Gebiet der Geographiegeschichte abliefert?
In einer Rezension des Buches, die im Dezember 1908 in der Neuen Zürcher Zeitung erschien, wird der Verfasser jedenfalls nur „Zürcher aus Thalwil“ und „unser Landsmann“ genannt. Von seiner künstlerischen Karriere in Frankreich wusste der Rezensent nichts zu berichten …
J.P. Zwickys „Genealogie der Familien Kölliker“ verzeichnet (unter Nr. 253) einen „Johann Oscar Kölliker“, der gleichfalls Bürger von Thalwil und dort auch wohnhaft war: „im Freihof, am See“. Dieser Johann Oscar Kölliker lebte von 1866 bis 1916 und war von Beruf Kaufmann. 1895 heiratete er Anna Huber aus Hirzel, mit der er zwei Töchter hatte. Neben seinem kaufmännischen Beruf betätigte er sich auch als Politiker, und er ließ sich offenbar mit seinem zweiten Vornamen anreden, denn von 1911 bis 1915 war ein „Oskar Kölliker“ aus Thalwil, geboren 1866 und verheiratet mit einer Huber, Mitglied des Zürcher Kantonsrats. Den Protokollen dieser Körperschaft ist auch zu entnehmen, welche Art von Handelsgeschäft Oskar Kölliker betrieb, nämlich eine „Weinhandlung“.
Die Weinhandlung des (Johann) Oskar Kölliker, der sich nach seiner Gattin auch „Kölliker-Huber“ nannte, dürfte mehr oder weniger ein Selbstläufer gewesen zu sein. Sonst hätte ihr Inhaber kaum so viel Zeit für sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement erübrigen können. Schon 1902 hatte Kölliker-Huber, wenn auch erfolglos, für den Zürcher Kantonsrat kandidiert. Davor war er bereits Mitglied des Gemeinderats von Thalwil, wo er sich nicht nur praktischen Angelegenheiten widmete wie der Errichtung einer kommunalen Wasserleitung, sondern oft auch repräsentative Pflichten wahrnahm, sei es, dass er bei der Einsegnung der katholischen Kirche von Thalwil 1899 den Geist der Ökumene beschwor oder dem „Gemischten Chor Thalwil“, als der mit einem Festakt im Hotel zur „Krone“ sein 75jähriges Jubiläum beging, die Glückwünsche der Gemeinde aussprach.
Überhaupt scheint Oskar Kölliker dem Feierlich-Musischen alles andere als abhold gewesen zu sein: ob Thalweil-Festspiel, Turn- oder Seesängerfest – der Weinhändler war stets vorne mit dabei, verkaufte Eintrittskarten, präsidierte in Organisationskomitees, hielt Reden, überreichte Fahnen und Lorbeerkränze, und als bei der „Schlußsitzung der Komitees für das kantonale Turnfest“ im Restaurant „Concorda“ noch „ein kleinerer Ueberschuß an Ehrenwein vorrätig war, entwickelte sich unter dem Vorsitze … des Präsidenten des Wirtschaftskomitees Herrn O. Kölliker noch einmal ein schönes Festleben, während dessen man sich der schönen Stunden des Turnfestes fröhlich erinnerte“. Bei all den Festivitäten vernachlässigte Oskar Kölliker offenbar weder seine bürgerlichen Pflichten – 1905 saß er in Winterthur, 1906 im benachbarten Pfäffikon als Geschworener im Gerichtssaal – noch seine Geschäfte. 1905 erschien im Zürcher Satireblatt „Nebelspalter“ zweimal folgende Anzeige:

Demnach importierte die Weinhandlung Kölliker direkt aus den Erzeugerländern, darunter aus Spanien (Malaga, Sherry), Portugal (Port, Madeira), Italien (Marsala) und Frankreich (Bordeaux). In welchen Sprachen wohl die Geschäftskorrespondenz geführt wurde? Halten wir einstweilen fest, dass Oskar Köllikers Geschäftspartner dieselben Sprachen sprachen, in denen auch die „Urtexte“ und „einschlägige Literatur“ zur Magellan-Expedition verfasst waren, welche ja die Grundlage für Oscar Koellikers Buch von 1908 bildeten.
Dass Oskar Kölliker, der Weinhändler, in seiner Jugend eine gründliche Ausbildung in modernen Fremdsprachen erhalten haben dürfte, darauf deutet eine andere Anzeige hin, die im April 1884 in der „Neuen Zürcher Zeitung“ geschaltet wurde:

Zum oder im „Freihof“ war der Wohnsitz Oskar Köllikers, der im April 1884 seinen 18. Geburtstag feierte. Sein Vater Johannes (1820-1891) war gleichfalls Kaufmann[5], handelte unter anderem in größerem Stil mit Kartoffeln[6]. Natürlich könnte Johannes Kölliker die Vermittlung von Schülern an das „Knabeninstitut Schmutz-Rolland“ am Genfer See einfach so als Nebengeschäft betrieben haben. Aber ist es nicht wahrscheinlicher, dass er auch seinen (einzigen) Sohn zur Ausbildung in dasselbe Institut gab, für das er als Vermittler tätig war? Zumal ja dessen Lehrangebot – „Hauptstudium: Französisch, Italienisch, Englisch und kaufmännische Fächer“ – perfekt auf das Anforderungsprofil eines zukünftigen Weinimporteurs zugeschnitten war.
Ob nun Absolvent des Instituts Schmutz-Moccand oder nicht – jedenfalls dürfte Oskar Kölliker, der Weinhändler, seine schulische Ausbildung Mitte der 1880er Jahre beendet haben. Demnach wäre ihm bis zu seiner Heirat mit Anna Huber im Dezember 1895 reichlich Zeit geblieben für jene langjährigen Aufenthalte „in Spanien, Portugal, Italien, Nord- und Südamerika“, von denen Oscar Koelliker, der Buchautor, im Vorwort schreibt. Und für einen angehenden Weinimporteur wäre es ja auch naheliegend gewesen, Reisen in Wein produzierende Länder zu unternehmen – um Sprach- und Fachkenntnisse zu vertiefen und um Geschäftskontakte zu knüpfen.
An den finanziellen Mitteln für solche Reisen wird es jedenfalls kaum gefehlt haben, denn die Familie Kölliker war allem Anschein nach wohlhabend. 1902 stellte O. Kölliker-Huber „umständehalber billig ein neueres Wohnhaus mit 4 Wohnungen und Werkstatt“ in Zürich zum Verkauf. Kurz zuvor hatte er zusammen mit einem „H.Huber-Welti“ – womöglich einem Verwandten seiner Frau? – das noch heute bestehende „Restaurant Waldhaus“ bei Station Sihlbrugg wahlweise zum Verkauf oder zur Vermietung inseriert. Und 1905 wurde O. Kölliker-Huber als Mitglied des Verwaltungsrats der „Aktienbrauerei Zürich“, des nachmaligen „Löwenbräu“, wiedergewählt.
Weinhändler, Bieraktionär, Immobilienbesitzer, Gemeinde- und Kantonsrat, Schöffe, Organisator von Festspielen, Turn- und Seesängerfesten … Oskar Kölliker aus Thalwil war offenbar ein vielseitiger Mensch und ein rechter Gschaftlhuber, dem man auch zutrauen würde, dass er ein Buch wie „ Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22“ publiziert hat. Kölliker müsste das Buch nicht einmal selbst geschrieben, er könnte auch einen Ghostwriter beauftragt haben. Allerdings sind ihm als Weinimporteur die nötigen Sprachkenntnisse ohne weiteres zuzutrauen, wie er auch die im Vorwort erwähnten Reisen unternommen haben könnte; zugleich verfügte er als wohlhabender Kaufmann anscheinend über die nötige Muße, um sich neben seinen Geschäften auch anderen Dingen zu widmen. Somit besteht kein Anlass, dem umtriebigen Weinhändler Oskar Kölliker die Autorschaft des Buches abzusprechen.
Auch sein frühes Ableben – Kölliker starb 1916 gerade 50jährig[7] – widerspricht dieser Hypothese nicht, datieren seine beiden einzigen Publikationen über Magellan doch von 1908 und 1912. Danach hat man nichts mehr von Oscar Koelliker, dem Buchautor, gehört.
- [1]Karl-Heinz Wionzek (Hrsg.), Another Report about Magellan’s Circumnavigation of the World. The Compilation by Fernando Oliveira. Revised and Expanded Edition, Manila 2021, S. 20 Anm. 18.
- [2]Familiengeschichtlicher Fachverlag J.P. Zwicky, Thalwil 1933.
- [3]Bd. 21, Leipzig 1927, S. 138.
- [4]Den Hinweis auf den Todesvermerk in den Nouvelles de Versailles gab mir der Wikipedia-Autor Mautpreller.
- [5]J.P. Zwicky, Genealogie der Familien Kölliker, Nr. 220.
- [6]Eine Ähnliche Anzeige findet sich auch in der NZZ vom 14.10.1877.
- [7]Im August 1915 trat O. Kölliker als Mitglied des Zürcher Kantonsrats zurück. Siehe auch die Notiz in der NZZ vom 16.08.1915.
[/read]
>> nach oben
Von Zeit zu Zeit seh ich
Veröffentlicht am 25. Oktober 2023
Den Alten hab ich länger nicht getroffen. Wir gingen früher öfter auf ein Bier. Ich seh ihn gerne, spricht er doch mit mir Als wie von Mensch zu Mensch und klagt mir offen Sein Leid. So wage er nicht mehr zu hoffen, Dass seine letzte Schöpfung: nämlich wir Uns jemals anders aufführn als ein Tier und friedlich leben, ohne uns zu zoffen. Schon damals, als er mir dies offenbarte, Da wusste ich ihm wenig Trost zu spenden, Obwohl ich nicht an Argumenten sparte. Er griff nach seinem Bier mit beiden Händen Und sprach betrübt: „Bei meinem grauen Barte! Ich werde das Projekt wohl bald beenden.“
>> nach oben
Ka-em-ha
Veröffentlicht am 6. Oktober 2021
Er will mit hundertfünfzig Kilometer Pro Stunde unsre Autobahn befahren. Was man da spart an Zeit im Lauf von Jahren, Die man am Steuerrad verbringt! Und steht der Verkehr, dann ists die Schuld der Schreibtischtäter In den Behörden, die zu säumig waren Im Straßenbau, verkündet mit Fanfaren Der fesche Landeshauptfrau-Stellvertreter. Der appelliert nicht nur an rechte Ränder Mit seinem populistischen Gezeter. Er setzt vielmehr die Nationalagenda. Denn auch der Kanzler hat präzis erkannt: Wir bleiben "weiterhin ein Autoland". Drum geht man hier zu Fuß nicht einen Meter.
>> nach oben
Was lange gärt, wird endlich Wut
Veröffentlicht am 21. September 2023
Mit unnachahmlichem Scharfblick hat die Regierung meines Wahlheimatlandes Niederösterreich als größten Hemmschuh der Umwelt- und Verkehrspolitik die sogenannten Klimakleber identifiziert. Logischerweise fordert die Regierung daher strengere Strafen für diese Leute, die ihre Mitmenschen ohne Grund beim Verkehr stören.
Wobei „Klimakleber“ ja nicht die einzigen Störenfriede sind, die einen am zügigen Fortkommen hindern. Neulich, im Verlauf einer tagesfüllenden Bahnfahrt quer durch Deutschland nach Österreich, wurden wir gleich zweimal durch einen „Notarzteinsatz“ aufgehalten. Kenner des Bahnbetriebs wissen, dass damit im Normalfall ein Schienensuizid gemeint ist. Die Mitte der Gesellschaft hat für diese Form der Selbsttötung überhaupt kein Verständnis. Sie sollte daher ebenfalls viel strenger bestraft werden!
Um aber auf die „Klimakleber“ zurückzukommen: Das Perfide an ihnen ist ja, dass sie mit ihren Aktionen auch unsere Landesbeamten und Politikerinnen ausbremsen, wo diese doch Tag und Nacht nichts anderes tun, als die richtigen umwelt- und verkehrspolitischen Maßnahmen zu setzen. Das kann man auch ganz konkret hier in unserem Weinviertler Städtchen beobachten.
Freie Bahn für freie Verkehrsexperten
Da gibt es eine ca. 1,2 km lange Straße namens „Alleegasse“, die einige außerhalb gelegene Ortsteile mit dem Zentrum verbindet. Die Alleegasse ist eng, kurvig und teilweise zugeparkt, weshalb Bürgerinnen und Bürger schon seit vielen Jahren fordern, sie für den Radverkehr sicherer zu machen. Denn wenn die Straße sicherer wäre, würden mehr Radfahrende sie nutzen, und das wiederum hieße: weniger Autos im Ortszentrum und weniger CO2-Ausstoß.
Der Stadtgemeinde leuchtete das ein. Sie ließ ein Konzept zur fahrradfreundlichen Umgestaltung der Alleegasse entwickeln und stellte es im Juni 2021 zur behördlichen Verhandlung. Da die Alleegasse eine Landesstraße ist, war auch ein Verkehrsexperte des Landes zugegen. Der Landesbeamte sah infolge der geplanten Umgestaltung große Risiken auf den Autoverkehr zurollen. Er forderte daher, erstmal weitere Studien zu erheben, um auf deren Grundlage einen neuen Lösungsvorschlag zu erarbeiten.

Bild: Radlobby Wolkersdorf
Nur zwei Rekordsommer später ist das Werk vollbracht. Die Alleegasse zieren jetzt Piktogramme, die Radfahrenden eine sichere Fahrlinie vorzeichnen sollen, und auf einer Länge von 487 m wurde gar die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabgesetzt (aber nur nachdem der Bürgermeister dem Landesvertreter erklärt hatte, dass die Herabsetzung absolut unerlässlich sei).
Interessantes Detail am Rande: Die Höchstgeschwindigkeit wurde am Ortsrand herabgesetzt, weiter stadteinwärts aber bei 50 km/h belassen, sodass Autos, je näher sie dem Ortszentrum kommen, wieder mehr Gas geben können. Für Radfahrende bedeutet das, dass ihr Weg in Richtung Zentrum zwar ein Stück weit sicherer geworden ist, sie aber noch immer nicht sicher bis ins Zentrum fahren können.
Trotzdem wird die Lösung von Kennern des Politikbetriebs als Meilenstein erachtet, weil sich das Land Niederösterreich dazu durchringen konnte, unglaubliche 487 m Landesstraße mit Tempo 30 zu belegen. Und das nach nur zwei Jahren Bedenkzeit.
Da soll noch wer behaupten, die Klima- und Verkehrspolitik in Niederösterreich klebe auf der Stelle!
Siehe auch:
Artikel Allee der Irrtümer (in „Die Furche“ vom 10. November 2021)
VCÖ-Initiative „Gemeinden und Städte für Tempo 30“
>> nach oben
Maschinenpark
Veröffentlicht am 5. September 2023
Jetzt zickt auch noch die Motorsense rum. Als hätt ich nicht Probleme schon in Massen! Zwar springt sie an, doch dann – ist es zu fassen? –, Sobald ich Gas geb, hört man ein Gebrumm, Und gleich darauf ist das Maschinchen stumm. Mit dem Vergaser scheint was nicht zu passen. Ich hab das Ding doch grad erst warten lassen. Allmählich wirds mir wirklich bald zu dumm. Die Nachbarn ringsum nützen längst Roboter, Um ihre Rasenflächen kurz zu halten. Doch unser Garten ist zu sehr verlottert, Um ihn mit solchen Mitteln zu verwalten. Und mein Maschinenpark wird immer schrotter. Ich hör bald auf, den Wildwuchs zu gestalten.
>> nach oben
Der Brotfachverkäufer*in
Veröffentlicht am 3. August 2023
Ein Bäcker in St. Pölten wollte ändern Den Namen eines Brotes, das sich gut Verkaufte. Also fasste er sich Mut Und machte etwas, das in andern Ländern Längst üblich: Er versuchte es mit Gendern. Doch wenn man sowas in St. Pölten tut, Entzündet unverzüglich sich die Wut, Die schwelt und knistert an den rechten Rändern. Ein Shitstorm braute drohend sich zusammen In jedem Social Media-Kanal. Der brave Bäcker sah bereits in Flammen Die Bäckerei und sich am Marterpfahl. Schnell hörte man „Entschuldigung“ ihn stammeln, Denn Gendern gilt als ziemlich radikal.
>> nach oben
So grün, wenn Spaniens Blüten
Veröffentlicht am 30. Juli 2023
Unlängst habe ich mich an dieser Stelle über den literarischen Fälscher Robert Grün ausgelassen, Schöpfer des Mönches „Celso Gargia“, der Pizarro bei der Eroberung von Perú begleitet und darüber ein Tagebuch hinterlassen haben soll. Dass Mönch und Tagebuch bloß Ausgeburten von Grüns Fantasie waren, ist 50 Jahre lang niemandem aufgefallen – auch nicht den Redakteurinnen und Redakteuren namhafter Schulbücher, die bis heute aus dem vermeintlich „zeitgenössischen Bericht“ zitieren.
Diese Geschichte ist inzwischen auch in der „Furche“ nachzulesen (leider nur für Abonnentinnen und Abonnenten; ein zweiwöchiges Probeabo ist jedoch gratis).
Bevor Robert Grün 1973 seinen „Celso Gargia“ erfand, hatte er 1968 eine Übersetzung von Antonio Pigafettas Reisebericht von der ersten Schiffsreise um die Erde herausgegeben. Grüns Pigafetta-Ausgabe wird immer wieder neu aufgelegt (die nächste Auflage ist für November 2023 angekündigt), obwohl sie einerseits ein dreistes Plagiat ist, andererseits eine Fälschung.
Plagiat, weil Grün großteils das Werk eines Schweizer Autors kopierte, ohne diesen zu nennen, nämlich Oscar Koellikers „Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22“.
Fälschung, weil Grün dem Bericht Pigafettas allerhand hinzudichtete, was seiner Fantasie entsprungen war: Geschichten von Sex & Crime, Mord und Totschlag, tödlichen Schlangenbissen, Kannibalismus u. dgl. m.
Belege für Plagiat und Fälschung habe ich in folgenden Dokumenten zusammengestellt (pdf_s zum Download):
„Dabei schnatterten sie wie die Gänse“
>> nach oben
Schlieren der Schöpfung
Veröffentlicht am 2. Juli 2023
Mit immerwährend großem Ruhm bedecken Tat sich der Schöpfergott, als er die Welt Erschuf und alles, was sie so enthält. Doch was nur wollte Er damit bezwecken, Als Er ins Dasein rief die nackten Schnecken? Die hat der Teufel wohl bei Ihm bestellt. Sie haben mir schon oft den Tag vergällt, Sind aller Gartenfreunde wahrer Schrecken. Das Schlimme ist an diesen grausen Tieren, Dass ihnen leider welkes Grün nicht reicht Und sie nach jungen Pflanzen immer gieren. Und wenn er seinem Beete naht, erbleicht Der Gärtner, weil er statt Salat bloß Schlieren Sieht und sein Garten einem Schlachtfeld gleicht.
>> nach oben
Penem et circenses
Veröffentlicht am 7. Juni 2023
Nicht Erwin Lindemann, nein, sondern Bill Benannte sich ein sehr berühmter Sänger. Der tourt mit seiner Gruselband schon länger Durchs Land, und die Konzerte sind der Thrill. Doch nach der Show wirds immer furchtbar still In Bill, da kriegt er immer voll den Hänger. Zum Glück ist er ein wahrer Seelenfänger, Der weiß, was so ein junges Mädel will. Er lässt die jungen Dinger sich von Schranzen Ins Hinterzimmer seiner Bühne führen, Wo sie nach Gabe chemischer Substanzen Für ihn allein hinter verschlossnen Türen Zutiefst entspannt ganz ohne Hemmung tanzen, Und Bill kann sie in Ruhe penetrieren.
>> nach oben
Copy if you can
Veröffentlicht am 17. Mai 2023
Dass Bücher „die schönste und interessanteste Ware der Welt sind, von der Wissen, Aufklärung und Weltverständnis ebenso ausgehen wie Verzauberung und Verführung“ – als Bücherliebhaber liest man gern, was der Verleger Lothar Wekel auf der Website des Verlagshauses am Römerweg schreibt. Aber schauen wir doch mal genauer, welche interessanten Waren dieses Verlagshaus vertreibt!
Unter seinem Dach logiert die Edition Erdmann, in der seit sechzig Jahren die großen Namen der europäischen Reiseliteratur, von Wilhelm von Rubruk bis Alfred Wegener, immer wieder neu aufgelegt werden. In dieser illustren Sammlung darf auch Antonio Pigafettas „Augenzeugenbericht von der ersten Weltumsegelung“ nicht fehlen. Die nächste Neuauflage ist bereits angekündigt, in einer wohlfeilen Ausgabe: „Das Original im Paperback“.

Bild: Wikimedia Commons
Das Etikett „Original“ scheint hier vor allem der Herausgeber zu verdienen: ein gewisser Robert Grün aus Wien, der offenbar ein Freund origineller Arbeitsmethoden war. Grün publizierte 1968 eine deutsche Fassung von Pigafettas Bericht im damaligen Horst Erdmann Verlag. 1970 legte er eine deutsche Bearbeitung des Bordbuchs von Christoph Columbus nach und 1973, gemeinsam mit seiner Frau, ein Buch über „Die Eroberung von Peru: Die Augenzeugenberichte von Celso Gargia, Gaspar de Carvajal, Samuel Fritz“, alle im Erdmann Verlag.
Was für eine beachtliche Reihe einschlägiger Veröffentlichungen! – dachte sich wohl ein Rezensent im Spektrum der Wissenschaft und attestierte dem Publizistenpaar Grün noch 2015, „ausgewiesene Kenner auf dem Gebiet der Historischen Geographie und des Zeitalters der Entdeckungen“ gewesen zu sein. Völlig zu Recht, denn:
Solche Kenner der Materie waren die Grüns, dass sie in ihrem Werk über die Eroberung Perus sogar einen „Augenzeugen“ jener bald 500 Jahre zurückliegenden Ereignisse präsentieren konnten, den bis dahin außer ihnen niemand gekannt hatte, nämlich den Augustinermönch „Celso Gargia“. Dieser „Fray Gargia“ soll Pizarros auf dessen Zug nach Peru begleitet und einen Bericht hinterlassen haben über das, was er dort mit eigenen Augen sah. Gefunden hatten die Grüns ihren „Zeugen“, wie sie einleitend erklärten, im Wiener Völkerkundemuseum (heute Weltmuseum), in einer dort befindlichen „Handschrift von Simancas“, deren Signatur sie freilich vergaßen anzugeben. Und das hatte seinen guten Grund …
[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]
Wie unlängst in der FAZ aufgedeckt, existiert diese Handschrift ebenso wenig, wie es jemals einen Celso Gargia gab. Wohl lebte einst in Spanien ein Augustinermönch namens Celso García, der auch tatsächlich als Autor eines Buches über „Pizarro o Historia del descubrimiento del Perú“ firmiert. Aber dieser Celso Garcia kam nicht im 15. oder 16. Jahrhundert, sondern 1884 zur Welt, und sein Buch erschien zuerst 1923 und trug den Untertitel „relatada a los niños“ – „erzählt für Kinder“.
Was die Grüns in ihrem Werk über „Die Eroberung Perus“ erzählten, war jedoch kein Kindermärchen, sondern eine Geschichte voller Blut, Fanatismus und Grausamkeit, die sie wohl im wesentlichen – so die Autoren des FAZ-Artikels – von dem amerikanischen Historiker William H. Prescott abgekupfert hatten. Dessen ursprünglich 1847 publizierte „History of the Conquest of Peru“ war kurz darauf auch auf Deutsch erschienen und 1937 in Wien neu aufgelegt worden. Das Ehepaar Grün tat nicht viel mehr, als Prescotts historische Erzählung in die erste Person umzuformulieren – fertig war der „Augenzeugenbericht“ des 16. Jahrhunderts, der in dieser Form sogar Eingang in deutsche und österreichische Schulbücher für Gymnasien fand.
Einschlägige vorstrafen
Der promovierte Altphilologe Robert Grün hatte offenbar bereits Anfang der 1930er Jahre, während seines Studiums an der Universität Wien, ein „entspanntes Verhältnis zur Wahrheit“ bewiesen, indem er die Unterschrift eines Professors fälschte und dafür eine Verwarnung und die Nicht-Anrechnung eines Semesters kassierte. Sein Titel wurde dem Herrn Doktor 1958 aberkannt, nachdem ihn das Landesgericht Linz wegen Veruntreuung von Verlagshonoraren zu einem Jahr „schwerer Kerkerstrafe“ verurteilt hatte, heißt es in dem FAZ-Artikel.
Nach dieser Lektüre war ich nun doch neugierig geworden, und so habe ich die Grün’sche Pigafetta-Ausgabe in der Edition Erdmann einer genaueren Prüfung unterzogen. (Dass ihr Text an vielen Stellen vom Original abweicht, war mir schon früher aufgefallen und der Grund, warum ich eine neue, authentische Übersetzung von Pigafettas Bericht anfertigte, die 2020 in der wbg erschienen ist.)
Die Textanalyse ergab, dass auch Grüns Pigafetta zu großen Teilen ein Plagiat ist. Als Kopiervorlage diente dem „Herausgeber und Übersetzer“ Robert Grün offensichtlich das 1908 im Piper-Verlag erschienene Buch von Oscar Koelliker: „Die erste Umsegelung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519 – 1522“.
Quellencollage als Kopiervorlage
Koelliker hatte Pigafettas Bericht (in der 1801 bei Julius Perthes erschienen Übersetzung von Amorettis Edition) mit anderen historischen Quellen montiert. Sein Buch ist eine Art Quellen-Collage, die sich zu einer umfassenden Darstellung von Magellans geschichtsträchtiger Reise aufsummiert. Um ein Beispiel zu geben:
In Pigafettas Schilderung der Schlacht von Mactan am 21. März 1521, die Magellan das Leben kostete, schob Koelliker einen Abschnitt aus dem Brief des Maximilianus Transylvanus „Über die molukkischen Inseln“ ein, der Magellan folgende Ansprache in den Mund legte:
„Lasset euch nicht einschüchtern, meine Brüder, von der Ueberzahl dieser Indier, unserer Feinde! Gott wird mit uns sein! Erinnert euch, dass vor kurzem der Kapitän Fernando Cortes in Yukatan mit 200 Spaniern 200.000 und 300.000 Indianer besiegte.“ (Koellikers Übersetzung)
Was allerdings Unsinn ist, denn die Nachricht von Cortés’ Umtrieben in Yucatán (bzw. Tabasco, denn gemeint ist wohl die Schlacht von Centla) gelangte erst im November 1519 nach Europa, zwei Monate nach Magellans Abreise von Kastilien, sodass dieser davon gar nichts wissen konnte. Aber egal. Transylvanus schrieb es, und Koelliker zitierte ihn. Zitierte ihn wohlgemerkt, wie es sich gehört, mit Angabe seiner Quelle. Grün wiederum übernahm das Zitat, aber ohne es als solches kenntlich zu machen. Bei ihm wirkt es, als hätte Pigafetta selbst die vermeintliche Rede Magellans berichtet. Und so ging Grün an vielen Stellen vor: Er übernahm Koellikers Einschübe in Pigafettas Text, aber anders als Koelliker kennzeichnete er sie nicht als Einschübe, sodass ein unbedarfter Leser nun für Pigafettas eigene Worte halten muss, was eigentlich aus anderer Quelle stammt.
Zwar wies Grün in einer „Anmerkung zur Edition“ darauf hin, am Text „geringfügige Veränderungen oder sogar Einfügungen“ vorgenommen zu haben, „die dem Brief des Maximilianus Transilvanus oder den Werken zeitgenössischer Historiker entstammen“. Aber er verschwieg, dass er diese Einfügungen nahezu wörtlich von Koelliker übernommen hatte und nannte weder dessen Namen noch dessen Buch. Auch verriet Grün nicht, dass er überdies noch weitere Passagen in Pigafettas Bericht eingefügt hatte, die weder bei Koelliker noch sonstwo dokumentiert sind, sondern gänzlich seiner eigenen Fantasie entsprungen waren.
Sex & Crime
In welchen Sphären sich die Fantasie des Ex-Doktors bewegte, lässt sich jenen Stellen seiner Pigafetta-Edition entnehmen, die sich nur dort und sonst nirgends in der Literatur finden. Da wird von Streit- und Mordfällen fabuliert, von sexuellen und kannibalistischen Gelüsten, verurteilten Ehebrechern, Meuterei-Komplotten, Schlangenbissen und dergleichen Dingen mehr – reinste Pulp Fiction, mit der Grün wohl Pigafettas Text aufpeppen wollte. Eine dieser Szenen gebe ich hier wieder. Sie soll sich während der monatelangen Fahrt über den Pazifik abgespielt haben, während derer die Besatzungen der Schiffe großen Hunger litten:
„Ich sah einen, der mit von Gier erfüllten Augen auf einen soeben verstorbenen Spanier starrte und dabei den Unterkiefer mahlend hin und her bewegte, und ich gab mich keinem Zweifel hin, daß dieser Seemann überlegte, welches Stück er aus dem Toten schneiden könnte, um es roh hinunterzuschlingen.“
Wie war das noch? Wissen, Aufklärung, Weltverständnis, Verzauberung und Verführung …
Bevor Sie nun der Verführung erliegen und sich – in der Hoffnung auf Wissen und Aufklärung – überlegen, Pigafettas schönen und interessanten Bericht von der ersten Erdumsegelung in der Edition von Robert Grün zu lesen: Vom allzu gierigen Verschlingen dieses Buchs sei abgeraten. Sie sollten es zuerst gründlich filetieren und unbedingt cum grano salis zu sich nehmen.
[/read]
>> nach oben
Populisten
Veröffentlicht am 17. April 2023
Wer schützt uns gegen Klimaterroristen, vor Genderwahn und Ökodiktatur? Wer kümmert sich um eigne Leute nur? Das schaffen ganz allein die Populisten. Und wehe, einer sagt, sie wär’n Faschisten! Denn kommst du ihnen auf die linke Tour, Dann schalten sie sekundenschnell auf stur Und setzen dich auf ihre schwarzen Listen. Sie finden, Fremde hätten zu viel Rechte Und Grenzen wär’n mit Stacheldraht zu stählen. In Putin sehen sie nicht nur das Schlechte Und Russland kann auf ihre Freundschaft zählen. Den Frieden stören bloß die Nato-Mächte. Da muss man eben Populisten wählen.
>> nach oben
Der Rechner Fantasie
Veröffentlicht am 1. April 2023
Erinnert sich noch jemand an die Dot com-Blase, jene große Hysterie? Inzwischen heißt das Zauberwort KI Und Algorithmus ist der neue Gott. Was Menschen denken, gilt doch längst als Schrott Verglichen mit der Rechner Fantasie; Es komponiert die schönste Melodie Und schreibt die feinste Lyrik uns ein Bot. Bedauerlich ist dieser Trend mitnichten. Wie viele Stunden hab ich schon verschwendet Mit Reime-Finden und Sonette-Dichten! Doch diese Mühsal ist nun bald beendet Und dank KI kann ich mein Sinnen richten Ganz auf die Dinge, die das Fernsehn sendet.
>> nach oben
Die großen Gräben
Veröffentlicht am 20. März 2023
Im schönen Bundesland Niederösterreich, das seit fast 18 Jahren meine Wahlheimat ist, in der ich als Ausländer aber nicht wählen darf, gibt es sehr tiefe Gräben. Den Ötschergraben zum Beispiel, eine tief eingeschnittene Felsschlucht von ehrfurchtgebietenden Dimensionen, die den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Aber der Ötschergraben ist nicht annähernd so tief wie die Klüfte, die sich durch die politische Landschaft Niederösterreichs ziehen und die politischen Lager des Landes voneinander trennen.

Bild: Wikimedia Commons
Nachdem die hierzulande seit 1945 regierende Volkspartei bei den Wahlen im Jänner 2023 ihre absolute Mehrheit verloren hatte, gelobte sie, „die Gräben zu schließen“. Die Gräben zu den Sozialdemokraten erwiesen sich jedoch schnell als unüberbrückbar, was nicht überraschte, hatte die Landeshauptfrau doch bereits vor Jahren erkannt: „Rote bleiben Gsindl“ . Was blieb ihr also anderes übrig, als den bodenlosen Schrund am äußersten rechten Rand der politischen Landschaft zuzuschütten und eine Landbrücke zur FPÖ zu schaffen, die aus den Jännerwahlen als triumphale Siegerin hervorgegangen war.
Um einen solchen Abgrund auszufüllen, müssen freilich unvorstellbare Mengen an Morast und Schotter bewegt werden, wie das „Arbeitsübereinkommen“ der beiden Parteien illustriert:
- So wird ein 30 Millionen Euro schwerer Fonds die „Schäden“, die durch die „Corona-Maßnahmen“ entstanden seien, „wieder gut machen“.
- Auf den Pausenhöfen der Schulen wird künftig die Verwendung der deutschen Sprache „forciert“.
- Dafür dürfen Wirtshäuser, die „ein traditionelles und regionales Speiseangebot“ aufweisen, mit Prämien rechnen.
- Wohl um den Arbeitsmarkt von Teilzeit arbeitenden Müttern zu entlasten, wird „die Kinderbetreuung im Familienverband“ eine „finanzielle Aufwertung“ erfahren.
- Dagegen soll das Land „für die überwiegend wirtschaftlich motivierten Zuwanderer möglichst unattraktiv“ gemacht werden.
- Für Autofahrer wiederum dürfte Niederösterreich noch attraktiver werden als bisher. Die Übereingekommenen bekennen sich nämlich zu „flüssigem“ Individualverkehr, Straßenbau und natürlich zur Krone der technologischen Schöpfung: dem Verbrennungsmotor.
- Der Individualverkehr sei „in Zukunft zu erhöhen“ und „vor mutwilligen Störungen zu schützen“. Daher wird „ein entschlossenes und rechtlich effektiveres Vorgehen gegen sogenannte ‚Klimakleber'“ für notwendig erachtet.
Freilich muss der immense Aushub an fossilem Gedankengut, mit dem der große Graben am rechten Rand der politischen Landschaft gefüllt werden soll, irgendwoher kommen, und so wird das Schließen des einen Grabens wohl andere Klüftungen vertiefen: zu denjenigen „Landsleuten“ nämlich, die sich ihre Zukunft nicht als Rückwärtsfahrt mit Vollgas in eine märchenhafte Vergangenheit vorstellen.
Schon werden die Böden hierzulande rissig von wochenlanger Trockenheit. Mit dem Klimawandel hat das aber bestimmt nichts zu tun. Ich glaube eher an einen Schadenszauber durch überwiegend wirtschaftlich motivierte Zuwanderer. Vielleicht sollte man zu dessen Abwehr ein paar Fremde lebendig begraben, wie es schon bei den alten Germanen gepflegter Brauch gewesen sein soll …
>> nach oben
Minimalinvasiv
Veröffentlicht am 14. März 2023
Es ist nicht die Art Literatur, die ich normalerweise lese: ausgedachte Geschichten, zudem noch kurze. Aber ein alter Freund hat sie geschrieben, und darum habe ich sie zur Hand genommen. Dass ich mich hier darüber äußere, ist allerdings kein Freundschaftsdienst. Das möchte ich gern vorausschicken. Sondern weil mir die Geschichten gefallen, die Florian Schneider erzählt.

Sie handeln von scheinbar alltäglichen Begebenheiten – nichts Weltbewegendem, könnte man sagen, dabei erzählen sie doch von dem, was die kleine Welt bewegt, in der eine jede und ein jeder von uns lebt: von Erinnerungen, Träumen, vor allem aber von den Beziehungen zu denen, die uns am nächsten sind, seien es Partner, Kinder oder auch Tiere.
Da sitzt ein Mann frühmorgens in einem Hotelzimmer und sieht sich auf einem Tablet Bilder an, Bilder von einem aggressiven Hirntumor. Sein Blick, das erfährt man bald, ist der des Fachmanns. Nachdem er genug gesehen hat, tippt er in das Bildschirmgerät den Satz: „Lasst es den Chirurgen machen.“ Eine lapidare Anweisung in einer Sache auf Leben und Tod, gerichtet an die Mitarbeiter in seiner Klinik, denen er offenbar nicht zutraut, was er selber in diesem Fall tun würde, wenn er vor Ort wäre: den Tumor „minimalinvasiv“ entfernen.
Denn der Mann am Tablet, so erfahren wir, ist ein Pionier minimalinvasiver Schädel-OPs, eine Koryphäe seines Faches. Aber er ist nicht vor Ort, sondern in einem Hotelzimmer auf Mauritius, mit seiner neuen, mutmaßlich jüngeren Frau, für die er mit Mitte fünfzig seine Familie verlassen und die sich die Insel im Indischen Ozean zum Ziel ihrer Hochzeitsreise erwählt hat, weil diese „so weit weg“ ist, „dass du es niemals in die Klinik schaffst“.
In einer anderen Geschichte blickt eine Frau aus dem Fenster ihres Schlafzimmer auf die Felder, die einmal ihrer Familie gehört haben. Es ist September, es ist extrem heiß, und der Mais auf den Feldern, nichts als Mais, bis zum Horizont, wird geerntet: „Sie sind mit zwei Maschinen gekommen und sie arbeiten gegenläufig, Reihe um Reihe. Sie reißen die Stängel aus der Erde, als wären es Grasbüschel und oben aus den Rohren schießt der Häcksel in die Anhänger wie der Strahl von Erbrochenem.“
Später, am Abend, wird die Frau gierig die Flasche Wein aus dem Kühlschrank an die Lippen setzen und, weil sie nicht schlafen kann, noch auf einen Absacker zu Don Alfonso in die Dorfkneipe gehen. Dort war sie früher oft mit ihrem Mann, der sich zu Tode gesoffen hat, und dort wird sie heute Abend auf die Fahrer der Mähdrescher treffen, Saisonarbeiter aus Osteuropa, die hier fremd sind wie sie, die Eingeborene …
Auf jeweils drei, vier, fünf Seiten gelingt es Florian Schneider mit seinen literarischen Momentaufnahmen, das Leben eines Menschen oder eines Paares einzufangen in seinem Beziehungsreichtum und seiner Brüchigkeit. Dass dabei vieles nur angedeutet wird und noch mehr ungesagt bleibt, der Fantasie des Lesers überlassen, ist alles andere als ein Manko. Die losen Enden machen – zusammen mit der akkuraten, niemals auftrumpfenden Sprache für mich den Reiz der Lektüre aus.
Es gibt auch ein paar längere Geschichten, wie die von den beiden jungen Leuten, Kollegin und Kollege in einer Berliner Werbe-Agentur, die eine romantische Beziehung eingehen. Aber mir gefallen die kurzen, die irgendwo einsetzen und ihre Story nicht bis zum Ende auserzählen, am besten. Ihnen allen wohnt eine Spannung inne, die mich von den ersten Zeilen an, wofern nicht um das Leben, so doch um die Seele der Protagonisten hat bangen lassen.
Florian Schneider, Polarstation. Erzählungen, Berlin: periplaneta 2022
>> nach oben
Klingt Sägelärm vom Forste
Veröffentlicht am 8. März 2023
Du hast ’nen Playsie-Pad aus Gold? Ich bin auf Kettensäge stolz!
Dass Holz sich gut als Brennstoff eignet, hat Sich unter Eigenheimbesitzern bald Herumgesprochen; wacker in den Wald Ziehn sie mit ihren Pick-Ups aus der Stadt. Mit Spaltaxt, Kettenöl und Sägeblatt Bewaffnet, kennt ihr Wüten keinen Halt. Weil ihre Badezimmer niemals kalt Sein sollen, machen sie die Wälder platt. Akazien, Buchen, Fichten, Eschen, Eichen: Im Zweitakt-Dunst gehn splitternd sie zu Boden. Sie müssen vor der Kettensäge weichen Und bleiben leblos liegen auf den Soden. Klingt Sägelärm vom Forste, ist’s ein Zeichen, Dass Ofen-Eigner uns’re Wälder roden.
>> nach oben
Business-Kollektion
Veröffentlicht am 27. Februar 2023
Mit Investoren Businesspläne schmieden Und sexy Kollektionen für die Massen Entwerfen täte wohl so manchem passen, Doch ist’s den meisten von uns nicht beschieden. Wir haben oftmals sogar ganz vermieden Und sträflich ignorant es unterlassen, Mit Modethemen ernst uns zu befassen, Und hatten trotzdem lange unsern Frieden, Bis ich vor kurzem in der Zeitung las Von einer Frau, die Leuten Kleider macht Und dass ihr das anscheinend großen Spaß Bereitet und zudem Fortuna lacht. Und ich sitz müßig hier herum, im Maß- Anzug, am Achterdeck von meiner Yacht!
>> nach oben
Der mit dem Hund tanzt
Veröffentlicht am 15. Februar 2023
Das folgende Sonett soll keinesfalls das Werk eines namhaften deutschen Choreographen beschmutzen:
Was geht in einem Menschen vor, der Scheiße Von einem Hund in eine Tüte schmiert Und damit einer Frau Gesicht traktiert, Nur weil sie seine Tanzrevue verreiße? Auch wenn des Mannes Weste eine weiße Bisher gewesen ist und Ruhm ihn ziert, So hat er seinen Ruf doch ruiniert Durch solch infames Hundekot-Geschmeiße. Der Nimbus ist ihm wohl zu Kopf gestiegen, Der ihn umgibt als Künstler und Genie. „Was ich erreicht, es will mir nicht genügen“, Befand er und ersann die Strategie: „Ich werde meine Kritiker besiegen Mit einer Kacki-Choreographie.“
>> nach oben
Normalerweise
Veröffentlicht am 13. Februar 2023
Normalerweise geht es in Sonetten
Um Liebesdinge, Herzschmerz und dergleichen.
Wen kann man denn mit sowas noch erreichen?
Als ob die Leut' nicht and're Sorgen hätten!
Sie wollen etwas and'res lesen, wetten?
Drum soll man solche soften Themen streichen,
Und alle Psycho-Dichter solln sich schleichen,
Sonst ist der Ruf der Dichtkunst nicht zu retten.
Wer dichtet, sollte sich an Straßen kleben
Und dort für ein paar Stündchen kleben bleiben.
Da würd man wirklich einmal was erleben.
Da ließen sich Sonette drüber schreiben.
Ich fühl den Zorn der Menge schon erbeben,
Wenn Dichter derart krassen Unfug treiben.
>> nach oben
Adiós, Magellan!
Veröffentlicht am 31. Januar 2023
Mehr als sechs Jahre lang bin ich ihm gefolgt: dem portugiesischen Ritter in spanischen Diensten und Heros der europäischen Seefahrt, Ferdinand Magellan, bin den Spuren nachgegangen, die er und seine verwegene Mannschaft in Archiven hinterlassen haben, bin lesend und recherchierend mit ihnen um die ganze Welt gereist. Früchte dieser Arbeit waren – nebst vielen Artikeln und Radio-Beiträgen – zwei Bücher, die offenbar beide ihre Leserinnen und Leser gefunden haben: die Monographie „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“, mittlerweile in 4. Auflage bei C.H. Beck Paperback erhältlich, und meine Neuübersetzung von Antonio Pigafettas legendärem Reisebericht, die erste vollständige und originalgetreue ins Deutsche. Unter dem Titel „Die erste Reise um die Welt. An Bord mit Magellan“ erschien sie 2020 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und war kurz vor Weihnachten schon zum zweiten Mal vergriffen (ist aber inzwischen ebenfalls wieder bestellbar).

Bild: Wikimedia Commons
Diese Geschichte zu erkunden und zu erzählen, war spannend, war lehrreich und hat vor allem mächtigen Spaß gemacht. Aber nach mehr als sechs Jahren ist es nun genug und an der Zeit, sich anderen Dingen zu widmen – oder um es mit einer Metapher aus dem (an Metaphern bekanntlich nicht armen) Reich der Seefahrt zu auszudrücken: Zeit ist es, zu neuen Ufern aufzubrechen.
Wohin die Reise geht, wird noch nicht verraten, nur mit gebührender Rührung Abschied genommen:
¡Que tenga Ud. buen viaje, comendador!
(PS: Ihre Fragen zum Thema beantworte ich, soweit ich kann, natürlich weiterhin: Kontakt.)
>> nach oben
In memoriam Heinz Erhardt
Veröffentlicht am 29. Dezember 2022
In unserer Reihe „Das humoristische Gelegenheitsgedicht“ präsentieren wir heute ein Stück, das der Gattung „Morgendliche Beinahe-Ergüsse“ zuzuordnen ist:
Ich lieg im Bett und muss aufs Klo. Nun ist es aber leider so: Das Klo ist weit. Der Gang ist kalt. So lieg ich schon geraume Zeit, Riskiere einen Harnverhalt Oder eine Überschwemmung, Weil von meinem Bett die Trennung Mir so schrecklick schwere fällt. Damit das Wehr noch weiter hält, Erzähl ich mir ein paar Geschichten Und übe mich derweil im – Dichten.
>> nach oben
Das Mäusekrematorium
Veröffentlicht am 12. Dezember 2022
Nach dem 2. Hauptsatz der Thermokrisendynamik steigt im proportionalen Verhältnis zum Preis fossiler Energieträger die Zahl an Ratschlägen zu deren sparsamer Verwendung. Folglich waren die Medien in den vergangenen Wochen voll von Artikeln, die einem erklärten, wie man „richtig“ heize und „richtig“ lüfte, sodass ich mich schon gefragt habe, wie wir Zeitungs- und Internetleser früher durch die kalte Jahreszeit gekommen sind, ohne solche sicherlich gutgemeinten Belehrungen.

Mich beschäftigt das Thema Heizen ja schon viel länger, als die aktuelle Energiekrise dauert, spätestens seit meine Frau und ich 2005 in ein schlecht isoliertes altes Haus am Lande gezogen sind. Über unsere Erfahrungen des ersten Winters schrieb ich damals einen kleinen Text, der – gedacht für den Hausgebrauch und als Beilage zur Familienchronik – bald in der Schublade verschwand. Wenn ich diesen mehr als 16 Jahre alten Text jetzt wieder hervorziehe und hier präsentiere, so geschieht das deshalb, weil ich selbst beim Wiederlesen überrascht war, wie viel von der aktuellen Krise bereits damals spürbar gewesen ist. Sogar der Oberschurke war schon derselbe …
>> nach oben
Schein oder nicht Schein
Veröffentlicht am 15. November 2022
Dass der Schein trügt, der schöne zumal, wird ihm oft bescheinigt. Manchmal allerdings zu Unrecht. So hieß es früher vom Hundert-Mark-Schein, dieser Schein trüge niemals. Zynisch gesinnte Zeitgenossen sagten gar von diesem Schein, er trüge als einziger nicht. (Das war allerdings vor der Währungsreform. Ob Leute vom Hundert-Euro-Schein dasselbe sagen würden, erscheint mir zweifelhaft; jedenfalls ist mir diese Aussage noch nie zu Ohren gekommen.) Zudem soll der eine oder andere Heilige den Schein seiner Heiligkeit nicht ohne Berechtigung tragen. Es scheint daher, dass der Schein nicht immer trügt, sondern manchmal doch der Wirklichkeit genügt. In solchen Fällen scheint mithin der Schein nur zu trügen, oder anders gesagt: Anscheinend kann es mitunter sein, dass ein Schein nur scheinbar trügt.
Es scheint übrigens Menschen zu geben, die es nicht ertrügen, wenn jemand anstelle von „anscheinend“ das Wort „scheinbar“ gebrauchte. Zu diesen zähle ich nicht, denn ich ertrage diesen immer öfter aufscheinenden Gebrauch klaglos, obwohl mir die Preisgabe der unscheinbaren Unterscheidung von „anscheinend“ und „scheinbar“ keineswegs harmlos erscheint. Dass beide Wörter nicht dasselbe meinen, ist doch offensichtlich. Und wer Schein und Wirklichkeit nicht (mehr) unterscheiden kann, hat augenscheinlich ein Problem, und zwar nicht bloß ein scheinbares.
>> nach oben
Sie wollen wieder schießen (dürfen)
Veröffentlicht am 5. Oktober 2022
Wenn man in Österreich eine „Hetz“ hat, dann bedeutet das, dass es lustig zugeht – zumindest für einige der Beteiligten, denn das Wort kommt von „Hatz“, was eine Art der Jagd ist. Eine Hetz war auch die gestrige Sondersitzung des österreichischen Nationalrats nur für einige der Teilnehmenden. Veranlasst hatte die Sitzung mit einer Dringlichen Anfrage der Klubobmann der Freiheitlichen Partei, Herbert Kickl.
Kickl, der sich als Cheftexter seiner Partei um die Pflege des Kalauers auf Wahlplakaten („Daham statt Islam“) und von 2017 bis 2019 als angeblich „Bester Innenminister aller Zeiten“ erfolglos um die Wiederaufstellung einer Polizei-Pferdestaffel verdient gemacht hat, nutzte die Nationalratssitzung zu einem Parforceritt auf seinem liebsten Steckenpferd: dem Schwadronieren vom „Asylanten-Grenzsturm“, der über Österreich hereinbreche.
Tatsächlich ist die Zahl der Menschen, die in Österreich einen Antrag auf Asyl stellen, in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Ende August summierte sie sich auf 56.149 seit Anfang des Jahres. Das entspricht fast einer Verdreifachung gegenüber 2021 – mithin ein perfekter Sturm kurz vor der Wahl des österreichischen Bundespräsidenten am Sonntag, bei der dem Kandidaten der FPÖ, einem Herrn Dr. Rosenkranz, nur geringe Chancen prognostiziert werden. Kein Wunder also, dass Kickl die Sturmglocken läutet.
Aber man sollte sich nicht täuschen. Seit Jahr und Tag lebt die FPÖ prächtig davon, sich als Anwalt der Kurzsichtigen, Kleingeistigen und Engherzigen aufzuspielen. Aus der Vielzahl globaler Probleme greift sie eines heraus, bläst es ins Gigantische auf und posaunt herum, Migration sei der fünfte Reiter der Apokalypse. Dabei lasse sie sich ganz einfach „verhindern“: mit Stacheldraht und Blei.
Mit dem alten Lied stoßen Kickl und sein blauer Verein auch heute nicht auf taube Ohren. Zwar wird die steigende Zahl der Asylanträge das fehlende Charisma ihres Kandidaten für das Präsidentenamt nicht aufwiegen. Würde jedoch stattdessen in Österreich am Sonntag der Nationalrat gewählt, erhielte die FPÖ voraussichtlich mehr als zwanzig Prozent der Stimmen.
 Um Bedrohungsfantasien, Gewalt und ihre Folgen geht es auch im neuen Buch meines Kollegen, des Historikers Hans Woller: „Jagdszenen aus Niederthann“. Hans erzählt darin eine Geschichte, die sich vor fast genau fünfzig Jahren in Oberbayern ereignet hat, in einem kleinen Weiler der Holledau, dem großen Hopfenanbaugebiet nördlich von München. Da feuerte ein Nebenerwerbslandwirt aus einem Kleinkalibergewehr vier Schüsse auf eine Gruppe von Mädchen ab. Die fünf nach damaligem Recht minderjährigen Mädchen hatten kurz zuvor unerlaubt – aber unbewaffnet – sein Haus betreten und waren bereits wieder am Wegrennen, als der Mann von hinten auf sie abdrückte.
Um Bedrohungsfantasien, Gewalt und ihre Folgen geht es auch im neuen Buch meines Kollegen, des Historikers Hans Woller: „Jagdszenen aus Niederthann“. Hans erzählt darin eine Geschichte, die sich vor fast genau fünfzig Jahren in Oberbayern ereignet hat, in einem kleinen Weiler der Holledau, dem großen Hopfenanbaugebiet nördlich von München. Da feuerte ein Nebenerwerbslandwirt aus einem Kleinkalibergewehr vier Schüsse auf eine Gruppe von Mädchen ab. Die fünf nach damaligem Recht minderjährigen Mädchen hatten kurz zuvor unerlaubt – aber unbewaffnet – sein Haus betreten und waren bereits wieder am Wegrennen, als der Mann von hinten auf sie abdrückte.
Zwei Kugeln trafen Anka Denisova, 18 Jahre alt und im sechsten Monat schwanger. Die Mutter von zwei kleinen Kindern verblutete an Ort und Stelle. Milena Ivanov überlebte, ebenfalls von zwei Schüssen getroffen, nach einer Notoperation. Sie und die anderen drei Mädchen waren nach Aussage ihrer Verwandten auf der Suche nach Menschen gewesen, die ihnen Lebensmittel verkauften. Alle fünf waren Romnja.
Die zum Tatort gerufenen Polizeibeamten nahmen die Mädchen wegen Verdachts auf Einbruch und Diebstahl fest, verhörten den Todesschützen als Zeugen und rieten ihm, sich zu verstecken, waren sie doch überzeugt, dass ihm nun „Blutrache“ drohte. Seinen Hof stellten sie vorsorglich unter Polizeischutz. Im Dorf ging fortan die Angst um vor der „Zigeuner-Rache“, und die Münchner Abendzeitung titelte „Zigeuner erklären Bauern den Krieg“. In den Augen seiner Nachbarn hatte der Schütze bloß recht getan, indem er sein Eigentum mit der Waffe gegen „diese Weiber“ verteidigte. Der Pfarrer auf der Kanzel sprach den Schützen von jeder Schuld frei, und der Bürgermeister wusste seine Partei hinter sich, wenn er schimpfte, es sei eine „Sauerei“, „dass ein anständiger Gemeindebürger wegziehen muss wegen dem Gesindel“.
So leicht kam der Täter am Ende nicht davon, aber nicht weil die Verwandten der Opfer ihm etwa den „Krieg“ erklärt oder gar „Blutrache“ geschworen hätten, sondern weil ein Münchner Staatsanwalt die bayerische Polizei daran erinnerte, dass das Gesetz auch das Leben von Roma schützt, und weil ein prominenter Rechtsanwalt, Rolf Bossi, sich des Falles öffentlichkeitswirksam annahm.
Die gerichtliche und mediale Auseinandersetzung um die tödlichen Schüsse in Niederthann sollte Jahre dauern und dazu beitragen, das Bild, das viele Deutsche von den Roma, aber auch diese selbst von sich hatten, zu verändern. Seit Jahrhunderten ausgegrenzt, im Dritten Reich zu Hunderttausenden ermordet, nach dem Krieg weiter diskriminiert, begannen deutsche Sinti und Roma, aufgeweckt von den Schüssen in Niederthann, um ihre Bürgerrechte zu kämpfen.
Diese Geschichte, vor fünfzig Jahren geschehen und dennoch erschreckend aktuell, erzählt Hans Woller in seinem Buch eindringlich und mit großer Empathie.
Hans Woller, Jagdszenen aus Niederthann
>> nach oben
Auf der Matte am Morgen
Veröffentlicht am 6. September 2022
Wie köstlich klingt doch das Flirren der Blätter, Wenn morgens der Wind durch den Garten streicht Und hoch in den Zweigen der Birke pfeift der Pirol. Das Fenster steht offen und ich auf der Matte Lieg selig da im Shavasana.
>> nach oben
Friede den Hütten!
Veröffentlicht am 24. August 2022
Diesen Sommer haben meine Frau und ich uns einen langgehegten Wunsch erfüllt. Während wir die Kinder glücklich mit den Großeltern am malerischen Längsee wussten, sind wir den Kreuzeck-Höhenweg gegangen: vier Tage Wandern über der Baumgrenze, auf schmalen, einsamen Pfaden, über denen Bartgeier ihre Kreise ziehen, mit herzerweiternden Aussichten auf Hohe Tauern, Karnische Alpen und Dolomiten.

Die Kreuzeck-Gruppe, ganz im Westen Kärntens zwischen Möll- und Drautal, gilt als eine der ursprünglichsten Gebirgsgruppen der Ostalpen. Trailrunner durchqueren sie in neun bis zehn Stunden. Sie springen über die Steige, ohne rechts noch links zu schauen. Genau das aber wollten wir gern. Daher haben wir uns in Summe zehnmal so viel Zeit genommen und in den bewirtschafteten Hütten der alpinen Vereine übernachtet.
Von ihnen gibt es in der Kreuzeck-Gruppe nur wenige, und es sind auch eher kleine Hütten, deren Bewirtschaftung kaum rentabel ist. Trotzdem werden sie von engagierten, ja man muss sagen: idealistischen Pächterinnen und Pächtern am Leben erhalten. Ein Segen für die Wanderer, die hier, mehr als 2000 Höhenmeter über Adrianiveau, ein warmes Lager und Nahrung finden, kühles Bier und – Geselligkeit.
Ein Freund von mir geht nicht zuletzt dieser Hüttengeselligkeit wegen in die Berge. Er liebt es, mit Kameraden, die vor einer Stunde noch Fremde waren, eng zusammengedrängt am Tisch zu sitzen, das Glas zu heben und nicht selten über die allerpersönlichsten Dinge zu reden. Ich dagegen muss gestehen, dass ich die Alpenvereinshütten eher utilitaristisch sehe. Ohne sie wäre das Wandern in den Bergen viel unbequemer, müsste man doch viele Kilos zusätzlich schleppen: Essen, Biwakausrüstung, Kocher usw. Und einen Ofen, an dem man nach einem Regentag sein Gewand trocknen könnte, fände man auch nicht so leicht.

Umso dankbarer bin ich den Hüttenwirtinnen und Wirten, dass sie ihre oft undankbare Arbeit machen. Den beiden Osttiroler Schwestern etwa, die sich von früh bis spät abrackern, um das Anna-Schutzhaus oberhalb von Lienz zu bewirtschaften. Das massive Holzhaus ist liebevoll renoviert, die Aussicht von der Terrasse phänomenal: Die Lienzer Dolomiten scheinen zum Greifen nah. Und doch müssen die beiden jungen Frauen zusehen, wie sie über die Runden kommen. Ist das Wetter zu heiß, zu kalt oder zu nass, bleiben die Gäste aus.
Kindheitstraum Hüttenwirt
„Man muss Spass haben, sonst kann man diesen Job nicht machen“, sagt Bruno. Lederhose, kariertes Hemd, weiße Haare: Wie das Urbild eines Tirolers sitzt er da, spricht aber breites Berlinerisch. Als Kind kam Bruno im Urlaub mit den Eltern auf die Feldnerhütte und beschloss: Wenn ich alt bin, werde ich hier Hüttenwirt. Inzwischen macht er den Job seit 18 Jahren. „Die wahre Hüttenzeit ist im September. Dann kommen die Einheimischen rauf und die Musi spielt“, schwärmt Bruno. Das Problem sei jedoch, belastbare Mitarbeiter zu finden: „Die halten das alle nicht mehr durch: drei Monate lang drei bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht. Nach sechs Wochen knicken die mir ein.“
Später, es ist längst dunkel, sitzt Bruno in der Küche am Funkgerät. Eine Gruppe Wanderer, die sich angekündigt hatte und für die er, weil die Hütte voll ist, draußen noch extra ein Zelt aufgestellt hat, ist verschollen. „Feldnerhütte an Salzkofelhütte, bitte kommen!“ – „Hier Salzkofelhütte, Servus Bruno“, krächzt es aus dem Lautsprecher. „Servus Helmut! Wie viele sind heute von euch weggegangen? Ich warte noch auf zehn Leute. Kommen!“

Nach mehrfachem Hin und Her, „Kommen!“ und „Ende!“ stellt sich heraus, dass die Verschollenen auf der Salzkofelhütte sind. Es sind aber nur zwei. Der Verbleib der übrigen acht bleibt ein Rätsel und das Zelt, das Bruno extra aufgebaut hat, leer.
Während Bruno vor sich hinschimpft, klingt Helmuts Stimme entspannt aus dem Äther. Ihn und seine Frau Barbara kennen wir bereits vom Vortag, als wir auf der Salzkofelhütte eingekehrt sind. Barbaras und Helmuts Kinder sind aus dem Haus, ihr Haus ist dauerhaft vermietet. „Wir sind jetzt Nomaden“, sagt Helmut. Im Sommer lebt das Paar auf der Hütte, kocht indische Linsen und „Spaghetti Veganese“ für Wanderer. Und im Winter? „Da sind wir im globalen Süden, wo wir verschiedene Sozialprojekte betreiben.“
Eine Art Sozialprojekt ist auch die Hugo-Gerbers-Hütte, auf 2400 Metern die höchstgelegene am Kreuzeck-Höhenweg. 20 Matratzenlager, kein fließend Wasser, Plumpsklo, die kleine PV-Anlage temporär außer Betrieb. Morgen zehn Uhr soll der Hubschrauber kommen, um die Grundversorgung zu sichern: 40 Kisten Bier. Alles Weitere muss vom letzten Parkplatz im Tal zu Fuß heraufgeschleppt werden, zwei Stunden steil bergauf.
Die Hugo-Gerbers-Hütte hat keinen richtigen Wirt. Sie wird von Freiwilligen bewirtschaftet. „Die meisten von uns kommen schon seit Jahren, nehmen sich extra Urlaub“, erklärt Niki, der schon als Säugling, im Tragetuch, erstmals hier oben war und sich seither mit dem Ort verbunden fühlt.
Matratzen unterm Sternenzelt
Umringt von gerölligen Gipfeln und Graten steht die Hütte unweit eines Baches auf einer breiten, grasbewachsenen Geländestufe. Unter der Fahne mit dem Alpenvereinswappen liegen zwei Doppelmatratzen mit Gummibezügen, für Frostresistente, die unterm Sternenzelt nächtigen wollen. Doch auch am Tag lohnt der Blick: Er reicht tief bis ins Drautal, über die bewaldeten, runden Rücken der Gailtaler Alpen auf die Zacken des Karnischen Kamms mit der Hohen Warte im Zentrum.

Niki leitet ein Team von sechs jungen Leuten, die er eingeladen hat, eine Woche mit ihm die Hütte zu betreuen: Wasserkanister auffüllen, Holz hacken, Gäste mit Getränken versorgen, sie in den Gebrauch des Plumpsklos einweisen, Lagerplätze zuteilen, Essen auf dem Holzherd kochen und servieren. Heute abend soll es eine „Hüttenschnitte“ geben, die sich als schmackhafte Pizza entpuppt. Wir dürfen reinhauen, bis wir platzen, denn Niki und sein Team haben für 20 Gäste gekocht, wir sind aber nur vier. Drei tschechische Mädels bereiten ihre mitgebrachte Mahlzeit draußen am Gaskocher zu. Die übrigen Plätze in der Gaststube wie auch im Lager bleiben leer. Wieder eine große Gruppe, die ihr Kommen angekündigt hat, aber nicht erschienen ist.
„Planen ist schwierig geworden“, sagt Niki, nachdem er vom Hüttengipfel abgestiegen ist, wo er in der Dämmerung vergeblich nach der Phantom-Wandergruppe Ausschau gehalten hat. „Schade. Wenn sie wenigstens Bescheid gegeben hätten! Gestern noch habe ich ein paar Leuten für heute absagen müssen, weil die Hütte komlett ausreserviert war.“

Wir nicken, auch wenn wir vom Nichtkommen der anderen profitieren: mehr Pizza, mehr Platz im Lager, keine Schlange vor dem Plumpsklo. Und als wir in der Früh zur nächsten Etappe aufbrechen, sind wir die einzigen, die sich auf den Weg machen. Stundenlang begegnen wir keiner Menschenseele, haben die ganze große Weite der Berge für uns.
>> nach oben
Abschnitt 4 EuGVVO ist nicht anzuwenden
Veröffentlicht am 21. Juni 2022
Gestern im Gerichtssaal waren alle auf meiner Seite: der Richter, meine Anwältin sowieso, sogar der Anwalt der Gegenpartei.
Ich hatte die Deutsche Bahn geklagt, nachdem sie meine Familie und mich an einem Abend Ende August 2021 am Bielefelder Bahnhof hatte stehen lassen und wir ihretwegen unseren Nachtzug nach Wien verpasst hatten. Da steht man dann mit zwei Kindern und muss zusehen, wie man bis zum nächsten Morgen in das 1000 Kilometer entfernte Zuhause kommt.
Als wäre das nicht schon Ärger genug, weigerte sich die Bahn auch, uns das Ticket für den verpassten Nachtzug zu erstatten. Es hatte immerhin 299 Euro gekostet. Weil wir wissen wollten, ob das rechtens ist, wandten wir uns an eine Rechtsanwältin, die für uns Klage einreichte. Nach dem gestrigen Gerichtstermin sind wir nur ein bisschen schlauer.
Das Bezirksgericht gab nämlich dem Einwand des Anwalts der Deutschen Bahn statt, dass der Fall nicht vor einem österreichischen Gericht verhandelt werden könne. Zwar steht in der EU-“Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen“, dass Verbraucher in ihrem Wohnsitzland Klage gegen Vertragspartner führen können, wenn diese dort eine Niederlassung haben. Das hat die Deutsche Bahn. ABER: In der Verordnung steht auch, dass dieses Prinzip „nicht auf Beförderungsverträge … anzuwenden“ sei.
Der Richter erklärte bedauernd, diese Klausel sei zum Vorteil der großen Flug- und Bahngesellschaften in die Verordnung eingefügt worden. Dagegen könne er nicht entscheiden. Das müsse auf EU-Ebene geändert werden. Ich hatte den Eindruck, dass der Richter uns gern Recht gegeben hätte. Selbst dem Anwalt der Bahn schien seine Rolle unangenehm zu sein, aber der gute Mann musste ja seinen Job machen. Und er machte ihn so gut, dass der eigentliche Inhalt unserer Klage gar nicht erst zur Verhandlung kam.
Jetzt verstehe ich besser, warum manche Leute meinen, dass die EU nicht die Interessen ihrer Bürger, sondern der Konzerne vertritt.
Hinterher fragte mich der Richter noch, ob ich weiterhin mit der Bahn führe. Ich zuckte mit den Achseln. Was bleibt einem anderes übrig, wenn man nicht auf Flugzeug oder Auto umsteigen will (oder kann)?
Wobei: Ein Freund von mir ist neulich mit seiner Tochter von München nach Peine zu seiner Mutter gefahren – mit dem Tandem. Sechs Tage waren sie unterwegs. Liegt hier womöglich die Zukunft der Mobilität? Ist zwar nicht so schnell, aber irgendwie reeller als von einer Bahn stehen gelassen zu werden, die die Verantwortung für die eigene Inkompetenz mit Hilfe von EU-Recht auf ihre Kunden abschiebt.
>> nach oben
Mit dem Hundeschlitten zum Stephansdom
Veröffentlicht am 9. Mai 2022
War ich neulich doch mal wieder im ersten Bezirk. Eine Redakteurin von Radio Stephansdom hatte mich ins Studio eingeladen, um über Roald Amundsen zu sprechen. Am 16. Juli jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag des berühmten Polarforschers. Er spielt eine Hauptrolle in meinem Buch „Das Eis und der Tod“ .

Bild: Noxstar8, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Alle Welt kennt Amundsen als „Bezwinger“ des Südpols, Wikipedia ihn auch als Kapitän des ersten Schiffes, das die Nordwestpassage durchfuhr, als Expeditonsleiter beim ersten Luftschiff-Flug über den Nordpol und Vollbringer weiterer polarer Heldentaten. Abseits solcher Bravourstücke war über den Menschen Roald Amundsen lange Zeit wenig bekannt. Der Entdecker unerforschter Landstriche war ein Meister im Verbergen seines Innenlebens.
Erst Tor Bomann-Larsen gelang es 1995 mit seiner grandiosen Biographie (deutsch 2007), die unkartierten Eiswüsten im inneren Kontinent des Roald Amundsen zu durchmessen. Bomann-Larsen zeigte auch, welchen bedeutenden Anteil der Geschäftsmann Leon Amundsen an den Erfolgen seines jüngeren Bruders Roald hatte – was diesen nicht daran hinderte, später mit Leon zu brechen und ihn öffentlich zum „Verräter“ zu erklären.

Bild: SDASM Archives, Public domain, via Wikimedia Commons
Roald Amundsen war zeitlebens viel unterwegs, vor allem mit Dampfer und Eisenbahn auf seinen Vortragstourneen, während er seine Polarreisen vorzugsweise mit Ski, Hundeschlitten, Segel- und Motorschiffen bestritt. Später entdeckte er das Fliegen für sich, allerdings weniger als Pilot denn als (prominenter) Passagier.
Die Frage des Transportmittels stellte sich auch mir, als ich in den ersten Wiener Bezirk fuhr. In die Stadt mit der S-Bahn, so viel war klar. Aber wie weiter? Bislang hatte ich stets das „Citybike“ genutzt, aber das ist von der Stadt Wien demontiert worden. Das Nachfolge-System verlangt ein Smartphone, das ich nicht habe.

Bild: Manfred Werner – Tsui, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Also das eigene Rad in den Zug geladen und damit bei prächtigem Sonnenschein vom Praterstern in den ersten Bezirk geradelt, bis zum Deutschordenshaus, wo unterm Dach Radio Stephansdom seine Studios hat. Im malerischen, gepflasterten Innenhof machte ein Mann sich mit dem Kärcher zu schaffen. Ringsum parkten Autos.
Wo man hier sein Rad abstellen könne, fragte ich den Mann. „Bitte nicht im Hof!“, rief er. „Wo denn dann?“, fragte ich. „Woher soll ich das wissen“, antwortete er und warf seinen Kärcher an. Nach einigem Suchen fand ich zwei Ecken weiter an der Straße einen freien Laternenmast. Im Studio angekommen, erzählte ich der Redakteurin von meiner Suche nach einem Radabstellplatz. „Oje, heikles Thema“, meinte sie: „Übrigens schon seit Jahrzehnten …“
Womöglich ist das eine Antwort darauf, warum in Wien eigentlich so wenige Menschen Fahrrad fahren.
>> nach oben
Meine Arbeit
Veröffentlicht am 4. April 2022
Meine Arbeit ist nicht das Wählen von Wörtern und daraus Ketten machen an einem roten Faden Meine Arbeit ist das Säubern des Ofens Ascheflocken die in der Luft tanzen Meine Arbeit ist das Spalten des Holzes der hohle Klang wenn das Scheit birst Meine Arbeit am Ofen: anheizen Nachlegen stündlich Tag für Tag Der Ofen und ich Er kennt seinen Herrn Ich bediene ihn Er dient mir Meiner Arbeit Lohn Wärme deren Preis nicht Krieg ist
>> nach oben
Wer eine Meise hat
Veröffentlicht am 15. März 2022
Ein paar Tage vor dem Angriff der russischen Staatsgewalt auf die Ukraine hatte ich ein Gedicht geschrieben, das ich an dieser Stelle veröffentlichen wollte, und zwar ein Sonett. So ein Sonett ist die Fingerübung eines Berufsschreibers, eine Tüftelei mit Worten, über deren Gelingen der Autor sich freut, sodass er sie gern herzeigt, ohne ihr jedoch größere Bedeutung zuzumessen – selbst wenn das Thema nur scheinbar unbedeutend ist. Das Sonett handelt nämlich von meinen Freunden, den Meisen. Aber als der Krieg ausbrach, erschien all das, die Meisen, das Sonett, mein literarischer Bastlerstolz, schlagartig bedeutungslos. Inzwischen denke ich, dass ich damit zumindest den Meisen Unrecht getan habe.
Gewalt macht mir seit jeher Angst, nicht zuletzt dann, wenn in mir drin die Wut hochkocht. Die Gefühle auszuhalten, die dieser Krieg beim vermeintlich abseits stehenden Zuschauer auslöst, Angst, Trauer, Zerknirschung und hilfloser Zorn, kostet Kraft. Dabei sollte ich mich als Historiker nicht wundern. Zivilisation und Verbrechen sind zwei Seiten derselben Medaille. Seit 1989 – dem Jahr, in dem ich volljährig wurde – herrschte auf der Erde immer irgendwo Krieg: von Irak, Jugoslawien und Tschetschenien über Kosovo, Afghanistan, wieder Irak, Jemen und Syrien bis zu den „Drogenkriegen“ in Mexiko und auf den Philippinen, um nur jene zu nennen, die mir ad hoc einfallen. Und doch war der russische Angriff auf die Ukraine ein Schock, ein körperlich empfundener Schock, den ich lange nicht werde verarbeitet haben. Tua res agitur, paries cum proximus ardet, haben wir seinerzeit in der Schule gelernt: Deine Sache steht auf dem Spiel, wenn die Nachbarwand brennt.

Что делать? Was tun, wenn es brennt? Die Menschen in der Ukraine zeigen es uns gerade: Sie lassen sich nicht zu Opfern machen. Zu den Dingen, die wir tun können – Geflüchteten helfen, Energie sparen, für Demokratie und Menschenrechte eintreten, gemeinsam mit unseren Kindern Gewaltfreiheit üben –, gehört auch, sich weder von der Gewalt noch ihrer Androhung einschüchtern zu lassen. Und für Autoren gehört dazu, weiter zu schreiben und zu publizieren. Das sind wir auch den Meisen schuldig. Darum:
Sei mir gegrüßt, befreund’te Schar der Meisen! Wie war der Garten eben noch so leer, doch nun ein wildes Schwirren hin und her, durchs Fenster trillern eure munt’ren Weisen. Man kann euch Meisen nicht genügend preisen. Der winterliche Garten läge sehr verödet da, erstarrt, kämt ihr nicht mehr, um ihn der Winterstarre zu entreißen. Ein gelbes, blaues, weißes, schwarzes Flattern – zwei kurze Beinchen reichen euch zum Klettern. Ihr macht nicht Halt vor Zäunen oder Gattern. Ihr turnt herum auf Ästen bar von Blättern. Und wenn im Wind die Fahnen klirrend rattern, dann dank ich euch als meines Tages Rettern.
>> nach oben
Völkerfreundschaft im Klassenzimmer
Veröffentlicht am 21. Februar 2022
Unsere Tochter lernt seit Beginn dieses Schuljahrs Russisch. Das Curriculum ihrer Schule verlangt eine dritte Fremdsprache. Französisch und Russisch standen zur Wahl. Ich glaube, dass sie sich aus Neugier für Letzteres entschieden hat. Russisch war für sie exotischer und damit interessanter.
Als der Kurs zusammentrat, zeigte sich, dass nur drei von 15 Schülerinnen und Schülern als Muttersprache Deutsch hatten. Die anderen sind mit zumeist slawischen Sprachen aufgewachsen, einzelne mit Russisch. Auch die Lehrerin ist Russin, im übrigen eine liebe Frau und engagierte Pädagogin, sodass das neue Fach unserer Tochter bald Spaß zu machen begann.
Doch die Freude ist mittlerweile verflogen. Das liegt weder an der Lehrerin noch an der Klasse oder etwa schulischen Misserfolgen. Vor ein paar Tagen sagte unsere Tochter beim Abendbrot, dass sie keinen Sinne darin sehe, die Sprache eines Landes zu lernen, das „solche Sachen macht“. Mit „solchen Sachen“ meinte sie den massenhaften Aufmarsch russischen Militärs an den Grenzen zur Ukraine. Was auch immer der Grund für diesen Aufmarsch ist, die russische Militärmaschinerie wirkt bedrohlich und gibt alles, nur kein sympathisches Bild ab.
Wir haben unserer Tochter gesagt, dass man unterscheiden müsse zwischen dem russischen Volk und der russischen Regierung. Was auch immer die Regierung im Sinn habe, die meisten Menschen in Russland wollten so wie wir in Frieden leben. Es seien nach unserer Erfahrung sehr herzliche, gastfreundliche Menschen, und es lohne bestimmt, ihre Sprache zu lernen.
Aber warum, fragte unsere Tochter, würden die Menschen in Russland dann zulassen, dass ihre Regierung andere Staaten bedroht? Warum würden die russischen Soldaten tun, was ihre Regierung sagt?
Darauf wussten wir keine rechte Antwort. Wir fragten unsere Tochter, ob sie schon im Unterricht über die Situation gesprochen hätten. Sie sagte, nur mit ihren Freundinnen, aber nicht mit der ganzen Klasse. Sie habe den Eindruck, dass die Lehrerin vermeide, über die politische Lage in Russland zu reden, vermutlich aus Angst, dass die Diskussion eskalieren könnte. Einige in der Klasse kämen nämlich aus Polen und der Ukraine, andere aus Russland, und die Stimmung sei ziemlich angespannt.
Was auch immer die russische Regierung in der Ukraine zu gewinnen hofft, die Herzen in Europa gewinnt sie damit kaum – auch nicht unter den wenigen jungen Menschen, die hierzulande Russisch lernen. Aber wozu auch braucht eine Großmacht wie Russland Freunde an einem Wiener Gymnasium?
Ergänzung am 1. März 2022
Als das Vorstehende geschrieben wurde, Anfang vergangener Woche, wollte auch ich noch nicht glauben, dass die russische Regierung Ernst machen und die Ukraine mit einem vorgestrigen Landkrieg überziehen würde. Seit dem Tag des Angriffs wird in der Russisch-Klasse unserer Tochter endlich über all das geredet, ausgiebig und offen. Die Oma einer Schülerin sitzt in Kiew, sitzt im Wortsinn, denn sie ist an den Rollstuhl gefesselt und kann nicht in den Luftschutzkeller fliehen. Die Lehrerin erzählt von einer Freundin in Russland, deren Sohn zum russischen Militär eingezogen wurde und die seit Tagen vergeblich in Erfahrung zu bringen versucht, wo ihr Sohn ist und wie es ihm geht. Schülerinnen und Lehrerin sprechen über ihre Ängste und ihren Schmerz. Es ist nur ein schwacher Trost – aber immerhin ein Trost, dass wenigstens in dieser Schulklasse kein Krieg herrscht.
>> nach oben
Omikron
Veröffentlicht am 7. Februar 2022
Seit mehr als einer Woche leisten also auch wir unseren Beitrag zum Erreichen der Herdenimmunität. Nachdem unser Sohn das Virus aus der Schule eingeschleppt hatte und krank wurde, ging es wie bei den Dominosteinen: Zwei Tage später ist meine Frau umgefallen, tags darauf ich, nur unsere Tochter trotzt bisher standhaft den unsichtbaren Invasoren. Wie es scheint, haben wir gottlob eh nur das, was die Virologen einen „milden Verlauf“ nennen. Aber auch wenn das Virus altersmilde geworden sein mag: Wir waren bloß froh, dass unsere Kinder aus dem Gröbsten heraus sind. Was Eltern von – womöglich gar erkrankten – Kleinkindern durchmachen, wenn sich beide gleichzeitig das Coronavirus einfangen, möchte ich mir nicht ausmalen. Knockout und Quarantäne sind schon keine gute Kombi. Aber Kleinkinder würden ihr die Krone aufsetzen.
Wer blöde Kalauer machen kann, muss sich auf dem Weg der Besserung befinden. Auch ein wieder erwachtes Interesse für die Außenwelt gilt ja gemeinhin als gutes Zeichen bei einem Kranken. Ob dieses Interesse seiner Rekonvaleszenz förderlich ist, steht auf einem anderen Paper. Der erste Blick über den Tellerrand unseres Quarantänehaushalts galt natürlich der allgemeinen Pandemielage. Und da lese ich gleich die Meldung, Herr Lauterbach habe getwittert: „Studien legen nahe, dass man sich relativ kurz nach der Infektion (mit ‚Omicron‘) wieder anstecken kann.“ Ich kann schon verstehen, warum dieser Mann vielen so sympathisch ist. Er ist immer so aufbauend. Aber hatte Herr Drosten nicht gerade erst erklärt, dass man nach drei Impfdosen und anschließender Infektion „auf Jahre hinaus“ immun sei? Frag zwei Ärzte, und du kriegst drei Antworten.
Wobei man als Laie ja froh sein kann, wenn diese Götter in Weiß in normaler Sprache zu einem sprechen. Auf orf.at wird ausgiebig Katharina Reich zitiert. Die Dame ist Vorsitzende der GECKO, der „Gesamtstaatlichen Krisenkoordination“, die am Wochenende ihre Strategie für den Herbst präsentiert hat. Diese beinhaltet eine Auffrischungsimpfung im September. Weil: „Dies nicht nur, um den Individualschutz zu verbessern, sondern auch den kurz dauernden infektions- und transmissionsreduzierenden Effekt der Boosterungen (den wir ja auch schon bisher gesehen haben) strategisch besonders gut für die Herbstwellendämpfung auszunützen. Dieser Effekt wird vor allem über die Antikörperbildung mediiert, die post-booster besonders gut ist.“
Das wird jedem Impfskeptiker unschwer einleuchten.
Wen wundert es da, wenn viele Menschen lieber Ricardo Leppe zuhören. Auf allen einschlägigen Kanälen holt der sympathische Jungunternehmer aus dem niederösterreichischen Gloggnitz die Menschen genau dort ab, wo sie sind. Ein Menschenfischer, der im Netz seine Netze auswirft: „Wenn’s dich hier schon mal hergetrieben hat, dann wirst du vielleicht auch spüren, da draußen, da passt irgendwo was nicht. Die einen fressen sich zu Tode, und die anderen haben nichts zum Essen. Da rennt doch irgendwas schief. Oder wo es dann heißt, nein, wir sind doch die höchst fortgeschrittene Zivilisation überhaupt, aber wir sind fast alle so krank wie noch nie … da passt doch irgendwas nicht zusammen.“
Was nicht passt, wird passend gemacht – dank Ricardo Leppe, der das Übel an der Wurzel packt, nämlich den Staat an seinem Bildungsystem. Mit seinem Aufruf, den öffentlichen Schule den Rücken zu kehren, findet er offenbar wachsenden Zulauf, vor allem unter Menschen, die Probleme mit dem Impfen haben.
Herr Leppe („Er wuchs mit veganer Rohkost auf, freilernend und lebte mit seiner Familie 3 Jahre in Peru im Urwald.“) gibt gern zum Besten, dass seine Eltern ihm bis zu seinem 10. Lebensjahr alles selbst beigebracht hätten – in nur 30 Minuten pro Woche! Das könnten andere Eltern auch und hätten dann reichlich Zeit, mit ihren Kindern spannendere Sachen zu machen. In den Wald gehen zum Beispiel.
Ich habe unsere Tochter gefragt, was sie besser fände, wenn sie die Wahl hätte: mit uns in den Wald oder in die Schule zu gehen? Die Arme, obwohl „pumperlg’sund“, hockt seit mehr als einer Woche in freiwilliger Quarantäne mit uns zuhause herum, um niemanden versehentlich anzustecken. Sie hat nur die Augen verdreht und geseufzt: „Ich wäre so gern bei meinen Freunden in der Schule“. Noch lieber wäre sie jetzt allerdings irgendwo im Süden am Meer. Wie sind eigentlich die Strände in Peru, Herr Leppe?
Nachträglicher Vorschlag am 8. Februar 2022
Warum nimmt unsere Regierung eigentlich nicht Herrn Leppe unter Vertrag, damit er für die Impfpflicht wirbt? Gewiss hat der Mann seine Prinzipien, und Prinzipien haben ihren Preis. Aber er scheint auch Geschäftssinn zu haben, und nachdem sich der Bund durch den Ausfall der Impflotterie 1,5 Milliarden Euro erspart, sollte das doch Spielraum für ein diskutables Angebot eröffnen. Gloggnitz wäre jedenfalls ein pittoresker Ort für ein Damaskus-Erlebnis …
>> nach oben
Ewig bleibt im Ohr der Klang
Veröffentlicht am 3. Januar 2022
Was FM4 angeht, war ich ja ein Spätberufener. Obwohl ich den Rundfunksender lange vorher kannte, habe ich ihn erst mit Anfang Vierzig so richtig entdeckt, dann aber so richtig, dass ich lang keinen anderen mehr gehört habe. Über Jahre hinweg blieb der Drehregler des alten Blaupunkt-Kofferradios in unserer Küche auf 103,8 MHz gestellt, und wenn ich der Hausarbeit nachging, kam mit den Wellen, die der Sender Kahlenberg auf dieser Frequenz ins Weinviertel ausstrahlt, ein wenig Weltläufigkeit und Progressivität in mein retardiertes Provinzdasein.
 Es war nicht so sehr, dass ich mich beim Hören von FM4 wieder jung fühlte. Eher war es der verspätete Genuss, zuhörend am Lebensgefühl einer Jugend teilzuhaben, die anders als meine nicht in den Zwängen einer bildungsbürgerliche Erziehung und der Auflehnung dagegen stecken geblieben war. FM4 klang einfach „lässig“, das heißt auch die Musik, vor allem aber die Leute hinter den Mikrofonen. Deren Stimmen und Namen wurden mir mit der Zeit vertraut, manche Stimmen mochte ich mehr als andere und eine ganz besonders, weil sich das Jugendhafte, das ich an FM4 liebte, in ihrem Klang verkörperte. So bekannte ich am 8. Januar 2012, also vor fast genau zehn Jahren, einer Freundin in Deutschland per Mail:
Es war nicht so sehr, dass ich mich beim Hören von FM4 wieder jung fühlte. Eher war es der verspätete Genuss, zuhörend am Lebensgefühl einer Jugend teilzuhaben, die anders als meine nicht in den Zwängen einer bildungsbürgerliche Erziehung und der Auflehnung dagegen stecken geblieben war. FM4 klang einfach „lässig“, das heißt auch die Musik, vor allem aber die Leute hinter den Mikrofonen. Deren Stimmen und Namen wurden mir mit der Zeit vertraut, manche Stimmen mochte ich mehr als andere und eine ganz besonders, weil sich das Jugendhafte, das ich an FM4 liebte, in ihrem Klang verkörperte. So bekannte ich am 8. Januar 2012, also vor fast genau zehn Jahren, einer Freundin in Deutschland per Mail:
„Habe ich Dir eigentlich mal von meinem Radio-Schwarm erzaehlt? Ich hoere, wenn ich Radio hoere, allermeistens fm4, das ist der progressive, jugendliche Ableger des ORF, und da gibt es eine Moderatorin, die ich immer besonders gern hoere: Gerlinde Lang. Nicht so sehr wegen dem, was sie erzaehlt, oder wegen der Musik, die sie auflegt (obwohl mir die auch oft taugt), sondern hauptsaechlich oder eigentlich nur wegen ihrer Stimme und ihrer Art zu sprechen. Ich habe kein Bild von der Frau, mache mir auch keins (und will irgendwie auch nie eines sehen), aber wenn ich das Radio einschalte und sie moderiert (immer nur) zufaellig, hebt sich sofort meine Laune.“
Seit zwei, drei Jahren höre ich nicht mehr so oft FM4 (was hauptsächlich an der Musik liegt, mit der ich immer weniger anfangen kann). Dennoch fiel mir irgendwann auf, dass Gerlinde Langs Stimme länger nicht zu hören war, und ich machte mir Gedanken, was wohl mit ihr los sei: Umzug ins Ausland, berufliche Neuorientierung, Babypause? Als ich dann wieder einmal zufällig in eine von ihr moderierte Sendung stolperte, freute ich mich sehr, dass es sie noch gab, und so war es ein jedes der immer selteneren Male, dass ich ihre Stimme vernahm.
Bis ich Sonntag abend auf einer Autofahrt den „FM4 Zimmerservice“ einschaltete und, nach Bob Dylans „Don’t Think Twice“, den Moderator sagen hörte: „… Gerlinde Lang, die wie gesagt letzte Woche gestorben ist“. Erst dachte ich, ich hätte mich verhört, aber auf der Internetseite des ORF fand ich die Bestätigung, dass die Moderatorin „am 28. Dezember nach langer schwerer Krankheit verstorben ist“.
Es stimmt mich traurig, dass ich beim Aufdrehen des Radios nie mehr unverhofft Gerlinde Langs Stimme hören werde. Doch sie wird mir im Ohr bleiben.
>> nach oben
Auf der Suche nach Hans
Veröffentlicht am 23. Dezember 2021
In seinem Frühneuzeitroman „Eine Geschichte des Windes“ erzählt Raoul Schrott „Von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal“. Unlängst erhielt ich die Anfrage, ob es diesen Kanonier tatsächlich gegeben und die Geschichte des Romans somit einen wahren Kern habe.
Ja, hat sie. Eine andere Frage ist, wie groß dieser Kern ist und wie fest.
In den Heuerlisten von Magellans Molukken-Expedition, die im spanischen „Indienarchiv“ in Sevilla verwahrt werden, finden sich die Namen von drei Männern, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Deutsche waren. Sie alle wurden als „Lombarderos“ angeheuert, das heißt als Geschützmeister, die sich auf die Bedienung schwerer Feuerwaffen verstanden (vom Wort „lombarda“, das im damaligen spanischen Sprachgebrauch einen schweren Geschütztyp bezeichnete; vgl. deutsch „Bombarde“). Einer der drei Männer hieß „Jorge“, also Georg, die anderen trugen beide den Namen „Hans“ bzw. „Hanse“.

Bild: Hispalois, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Offenbar hatten die spanischen Schreiber es nicht so mit deutschen Namen. Mal buchstabierten sie „Hans“, mal „Hanse“, dann wieder „Anes“ (sprich „Hannes“). Doch unsere beiden „Hanse“ lassen sich trotzdem gut auseinanderhalten. Erstens wurden in den Heuerlisten auch die Namen ihrer Herkunftsorte und Eltern verzeichnet, und zweitens dienten sie auf verschiedenen Schiffen, Hans Nummer 1 als „condestable“, das heißt Chef der Artillerie, auf der Nao Concepción und Hans Nummer 2 als „lonbardero“ (sic!) auf der Nao Vitoria. Dieser zweite Hans war „gebürtig aus Agan“, was gemeinhin mit „Aachen“ gleichgesetzt wird.
Als die Nao Vitoria Anfang September 1522 nach fast dreijähriger Odyssee rund um den Globus – der ersten historisch belegten Umrundung der Erde – wieder einen spanischen Hafen anlief, befand sich unter den 21 Überlebenden an Bord auch ein „Anes lonbardero“. Dass dies Hans 2 war, der mutmaßliche Aachener, geht aus der Endabrechnung seiner Heuer hervor, wo aufgeführt ist, dass er während der gesamten Fahrt auf der Vitoria gedient hatte, am Ende im Rang eines „condestable“.

Bild: Archivo General de Indias, CONTRATACION,5090,L.4, f. 47r(Ausschnitt)
Im übrigen umrundete auch Hans Nummer 1 die Erde, allerdings nicht an Bord der Vitoria. Der in den Dokumenten zumeist „Hanse Vargue“ (sprich „Hans Barge“) Genannte geriet auf den Molukken in portugiesische Gefangenschaft. Jahre später, 1526, gelang ihm auf einem portugiesischen Schiff die Rückkehr nach Lissabon, wo er kurz darauf im Kerker starb.
So weit, so gut – oder ungut. Aber wie steht es mit der zweiten und dritten Umrundung der Erde?
Dass der Geschützmeister Hans aus Aachen ein zweites Mal um die Welt gesegelt und damit der erste Mensch sei, dem solches gelang, liest man nicht nur im Roman von Raoul Schrott, sondern auch auf Wikipedia. Zum Beleg wird dort auf das Buch „The First Circumnavigators“ verwiesen, in dem der amerikanische Forscher Harry Kelsey Geschichten über „die ersten Weltumsegler“ zusammengetragen hat. Darin erfährt man, dass besagter Hans auch auf der zweiten spanischen Molukken-Expedition anheuerte, die 1525 unter dem Kommando von García Jofre de Loaísa in See stach. Diese Expedition nahm ein sehr unglückliches Ende.
Nur eines von sechs Schiffen erreichte die Molukken, keines kehrte nach Europa zurück. Lediglich ein paar versprengte Überlebende fanden Mitte der 1530er Jahre, so wie zehn Jahre zuvor die letzten Veteranen der Magellan-Expedition, auf portugiesischen Schiffen den Weg zurück in die Heimat. Einer davon war Andrés de Urdaneta, der später eine gewisse Berühmtheit erlangen sollte, weil er zu den ersten Europäern zählte, denen die Überquerung des Pazifik von Westen nach Osten gelang. Aber das war erst 1565 und ist eine andere Geschichte.
Nachdem Urdaneta 1536, auf dem Weg über Indien, von den Molukken nach Europa zurückgekehrt war (und damit gleichfalls die Erde umrundet hatte), schrieb er einen Bericht über die gescheiterte Loaísa-Expedition. Unter den Teilnehmern erwähnt er einen gewissen „maestre Ans, condestable de los lombarderos“, also sinngemäß „Meister Hans, Chef der Artilleristen“. Über diesen „Meister Hans“ sagte Urdaneta aus, dass er zuvor schon mit Magellan zu den Molukken gefahren sei. Es kann sich dabei nur um Hans aus Agan/Aachen (Hans 2) handeln, weil dessen Namensvetter (Hans 1) ja bis 1526 in portugiesischer Gefangenschaft verblieb und dort starb.
Die Teilnehmer der Loaísa-Expedition von 1525, die es bis zu den Molukken geschafft hatten, lieferten sich dort einen jahrelangen, blutigen Kleinkrieg mit den Portugiesen. In diesem Zusammenhang erfahren wir aus Urdanetas Bericht über Meister Hans, dass er 1529 mit einigen seiner Kameraden zu den Portugiesen übergelaufen sei. Was danach aus ihm wurde, ist nirgends dokumentiert. Nur eine Handvoll von Loaísas Leuten schaffte es am Ende, über Portugiesisch-Indien nach Europa zurückzukehren. Und wiederum nur von einigen sind die Namen überliefert. Ein Hans, „Anes“ oder „Ans“ ist nicht darunter.

Bild: HHEHUM, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Nun ist die Loaísa-Expedition nicht annähernd so gut dokumentiert und erforscht wie ihre Vorgängerin, die Armada des Magellan. Es könnte daher sein, dass noch irgendwo im Indienarchiv ein Aktenbündel herumliegt, aus dem wir mehr über das weitere Schicksal des Geschützmeisters Hans erfahren würden. Doch zumindest in den digitalisierten Beständen, die über das „Portal der spanischen Archive“ zugänglich sind, war nichts dergleichen zu finden.
Worauf stützt sich also die Behauptung, dem Hans aus Agan/Aachen sei ein zweites Mal die Umrundung der Erde geglückt?
Harry Kelsey verweist in seinem Buch „The First Navigators“ auf einen weiteren Expeditionsbericht, der, handgeschrieben und ohne Nennung des Autors, unter der Signatur Add. MS 9944 in der British Library aufbewahrt wird. Von diesem Bericht wurde bisher nur ein Teil gedruckt, aber erfreulicherweise hat die australische Nationalbibliothek ein vollständiges Digitalisat ins Netz gestellt. Der Bericht handelt im wesentlichen von einer weiteren spanischen Ostasien-Expedition, die 1542 unter dem Kommando von Ruy López de Villalobos von Neu-Spanien aus, dem heutigen Mexiko, in See stach, um die Philippinen anzusteuern.
Tatsächlich wird darin (Kapitel 31, f. 55v) abermals ein deutscher Geschützmeister namens Hans erwähnt, nämlich „un lombardero alemán llamado mahestre Anse“ (an anderer Stelle als „artillero mahestre Ans“). Dieser Hans half den Teilnehmern der Villalobos-Expedition mit einem von ihm bedienten Geschütz aus der Patsche, als sie auf den Inseln Sarangani und Balut, an der Südostspitze Mindanaos, von einheimischen Kriegern bedrängt wurden. (Die Spanier waren anscheinend am Verhungern und steuerten daher die Inseln an, um Nahrungsmittel notfalls zu rauben, was sich die Einheimischen, wenig verwunderlich, nicht gefallen ließen.)
Wenn ich richtig sehe, war es diese Erwähnung, die Harry Kelsey veranlasst hat, jenem Hans aus Agan/Aachen, der 1519 bis 1522 auf der Nao Vitoria die Erde umrundete, noch eine zweite komplette Erdumsegelung zuzuschreiben. Denn wenn derselbe Hans sich 1542 unter López de Villalobos auf die Philippinen einschiffte, musste er ja zuvor von den Molukken, wo seine Anwesenheit 1529 dokumentiert ist, nach Mexiko gelangt sein, zum Ausgangspunkt der Villalobos-Expedition. Da die West-Ost-Überquerung des Pazifik bis dato keinem europäischen Schiff gelungen war, konnte er dorthin nur auf dem Weg über Indien und Europa gelangt sein, das heißt indem er ein weiteres Mal die Erde umrundete.

Bild: Lisuarte de Abreu, Public domain, via Wikimedia Commons
Kelsey macht diese Argumentation nirgends explizit, aber sie ist die einzige schlüssige Begründung für seine Behauptung, die ich mir denken kann. Einen anderen Hinweis, zum Beispiel Heuerlisten, wie sie von der Magellan-Expedition überliefert sind, habe ich bisher nirgends entdecken können. Zwingend ist diese Argumentation freilich nicht und die zweite Erdumrundung von Meister Hans in meinen Augen daher nicht als historische „Tatsache“ anzusehen.
Zwar gibt es belastbare Belege dafür, dass ein Hans aus „Agan“ (Aachen?) an Magellans Molukken-Expedition von 1519 teilnahm, auf der Nao Vitoria die Erde umrundete und 1522 nach Spanien zurückkehrte, sich 1525 unter Loaísa abermals zu den Molukken einschiffte und sich bis mindestens 1529 dort aufhielt. Aber dieser Hans muss nicht derselbe Hans sein, der 1543 auf Sarangani sein Geschütz in Stellung brachte.
Jedenfalls lässt sich aus der Namensgleichheit nicht zwingend auf die Identität der Person schließen, selbst wenn beide denselben Beruf des Geschützmeisters ausübten. Dafür war Hans seinerzeit einfach ein zu häufiger Name, wie man ja schon daran sieht, dass auf Magellans Expedition gleich zwei „Hanse“ mit demselben Metier anheuerten – ganz abgesehen von ihren zahlreichen spanischen und italienischen Namensvettern, all den Juans und Giovannis, die ebenfalls mitfuhren. Aus der Geschichte der Frühen Neuzeit und mehr noch des Mittelalters kennt man dieses Phänomen zur genüge: die Häufung gleicher Namen ohne weitere Spezifizierung, die bei der Identifizierung von historischen Individuen Probleme macht und oft zu Fehlschlüssen verleitet.
Aber selbst, wenn der Hans von 1519/29 und jener von 1542 dieselbe Person waren, was ja immerhin möglich ist: Wer sagt, dass dieser Hans, nachdem er 1529 auf den Molukken zu den Portugiesen übergelaufen war, überhaupt nach Europa zurückgekehrt ist? Von anderen Teilnehmern der Expedition, die in portugiesische Gefangenschaft geraten waren, weiß man, dass sie bereitwillig in Asien blieben. Einzelne gründeten dort sogar Familien, andere reisten weiter, zum Beispiel nach China. Rein theoretisch könnte unser Hans daher auch in Südostasien geblieben und, auf welchem Wege auch immer, auf die heutigen Philippinen gelangt sein, wo er sich wieder den Spaniern angeschlossen hätte, die 1543 dort landeten.
Was von weitem wie eine „historische Tatsache“ aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung oft als grobkörniges, unscharfes Gebilde mit wenigen klaren Konturen, aber dafür umso mehr Schattierungen und grauen Flächen, die sich für Projektionen aller Art eignen. Was nach meinem Verständnis den Historiker vom Dichter – und die Historikerin von der Dichterin – unterscheidet, ist die Art und Weise, wie wir mit dieser Sachlage umgehen. Auch wir müssen Leerstellen in der Überlieferung überbrücken, zuweilen unscharfen Dingen klarere Konturen geben, müssen dabei aber stets den Unterschied kenntlich machen zwischen dem, was durch die Quellen, Dokumente, archäologische Funde usw. vorgegeben ist, und den Gedanken, die wir aus diesen Gegebenheiten entwickeln. Ich denke, dieser Unterschied ist wichtig.
Daher mein Fazit: Es ist durchaus möglich, dass der Geschützmeister Hans aus Agan (Aachen?), der 1519 bis 1522 auf der Nao Vitoria die Erde umrundete, dies zwischen 1525 und 1535 ein zweites Mal tat. Erwiesen ist es (bisher) nicht.
>> nach oben
Impfen und Freiheit
Veröffentlicht am 24. November 2021
Als unser erstes Kind auf die Welt kam, haben wir viel mit unserer Kinderärztin diskutiert, einer sehr erfahrenen Frau, die einerseits alternative Medizin wie etwa Homöopathie praktizierte, andererseits aber vehemente Befürworterin des Impfens war. Wir dagegen machten uns Sorgen, dass unsere Tochter, ein zartes Wesen, an den zahlreichen empfohlenen Impfungen Schaden nehmen könnte. Zudem sahen wir nicht ein, warum das Kind gleich gegen sechs Krankheiten auf einmal geimpft werden musste, darunter gegen Keuchhusten, der zwar unangenehm ist, aber nur sehr selten lebensbedrohlich verläuft, und gegen Hepatitis B, mit dem sich ein gestillter Säugling, der in behüteten europäischen Verhältnissen aufwächst, schwerlich ansteckt.
Die Diskussionen zogen sich über Monate hin. Längst hatten wir den ersten Geburtstag unserer Tochter gefeiert, als wir den Argumenten unserer Ärztin endlich nachgaben und sie erstmals impfen ließen. Seither sind viele Jahre vergangen, und sowohl unsere Tochter als auch ihr jüngerer Bruder haben im Lauf der Jahre eine Reihe von Impfungen erhalten, die sie allesamt gut vertragen haben, unsere Tochter im vergangenen Juni auch die Covid-Impfung mit Comirnaty. Beide sind gesunde Kinder, nur selten krank, und sie entwickeln sich gut. Ob trotz oder wegen der Impfungen, kann ich nicht sagen, nur dass diese ihnen bisher anscheinend nicht geschadet haben – genauso wenig wie mir und meiner Frau.
Umgekehrt halte ich es für einen Irrglauben, dass Impfungen das wichtigste oder gar einzige Mittel sind, um gesund zu bleiben. Dazu braucht es nach meiner Erfahrung auch reichlich Bewegung an der frischen Luft, eine ausgewogene Ernährung, ein gewisses, nicht zu hohes Maß an Hygiene und noch etliches mehr, zum Beispiel eine Familie, Freunde, Musik, gute Bücher und einen Sinn in dem, was man tagtäglich tut. Von daher bedaure ich, dass die politischen Anstrengungen zur Überwindung der Covid-Pandemie fast ausschließlich auf die Ausmerzung des Krankheitserregers durch Impfung hinauslaufen. Auch der moralische und demnächst auch gesetzliche Druck, der auf Menschen ausgeübt wird, die nicht geimpft sind, ist mir zutiefst zuwider. Er geht mir gegen den Strich meiner liberalen Gesinnung.
Was staatlicher Zwang ist, habe ich als junger Mann am eigenen Leib erfahren. Als Kriegsdienstverweigerer musste ich fünfzehn Monate lang in einem Krankenhaus im Schichtbetrieb Pflegedienst leisten, für Kost und Logis und ein Taschengeld. Und das, um ein Gesundheitssystem am Laufen zu halten, das von Ungerechtigkeit und Ausbeutung derer geprägt ist, die darin arbeiten. Diese Erfahrung hat, um es vorsichtig auszudrücken, keine Liebe zum Staat in mir erweckt. Eine solche Liebe verspüre ich bis heute nicht, aber nachdem ich ein wenig in der Welt herumgekommen bin, sehe ich mittlerweile die Vorteile eines staatlichen Gewaltmonopols. Im Rückblick sehe ich auch den Zivildienst nicht mehr nur negativ, obwohl ich den Zwang zu einem solchen Dienst nach wie vor ablehne. Ein erwachsener Mensch sollte für alles, was er tut oder unterlässt, selbst Verantwortung übernehmen.
So verteidigte der Mennonit Daniel Musser während des amerikanischen Bürgerkrieges 1864 das Recht von Christen, den Kriegsdienst zu verweigern, weil dieser nicht mit Jesu Gebot der Gewaltlosigkeit vereinbar sei. Zugleich begründete Musser in seiner Schrift „Non-Resistance Asserted“, dass jemand, der Gewalt ablehne und dem Staat nicht mit der Waffe dienen wolle, konsequenterweise auch weder den Schutz des Gesetzes noch die Dienste der Staatsgewalt, etwa der Gerichte oder Polizei, für sich in Anspruch nehmen dürfe. Die Staatsgewalt abzulehnen und gleichzeitig von ihr zu profitieren, ist ein ethischer Widerspruch.
Dasselbe gilt in nach meinem Verständnis auch für die Covid-Impfung und das gesetzliche Gesundheitssystem. Zweifellos gibt es viele Gründe, sich nicht gegen Covid impfen zu lassen. Allerdings würde ich erwarten, dass diejenigen, die sich aus freien Stücken gegen die Impfung entscheiden, eine Patientenverfügung unterschreiben, durch die sie im Fall einer Erkrankung an Covid darauf verzichten, in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen behandelt zu werden. Wären alle Ungeimpften so konsequent, dann würde sich nicht nur die Lage auf den Intensivstationen entspannen, sondern im ganzen Land. Eine Impfpflicht wäre aller Wahrscheinlichkeit nach unnötig, und die unselige Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, die seit Wochen den öffentlichen Diskurs vergiftet, würde geheilt.
Liebe Impfskeptiker, bitte seid so frei: Tut, was ihr für richtig haltet, aber übernehmt Verantwortung für eure Entscheidung!
>> nach oben
Überlegungen zur bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs
Veröffentlicht am 21. September 2021
Ganz früher schrieb ich öfter mal Sonette.
Ich saß herum und dachte lange nach,
ich brachte Verse unter Dach und Fach
und suchte Reime, knackige und fette.
Doch das ist lange her. Es ist, als hätte
ich diese Kunst verlernt, als läg’ sie brach.
Schon gräm ich mich deswegen, doch Gemach!
Für Selbstzerfleischung ist hier nicht die Stätte.
Jawohl, Sonette schreiben, das ist Arbeit
und nichts, was man so nebenbei vollbringt.
Das macht man nicht aus Jux in seiner Freizeit,
so wie man in der Badewanne singt.
D’rum haltet meinen Jubel nicht für Tollheit,
wenn ein Sonett mir wieder mal gelingt.
>> nach oben
Alles gut
Veröffentlicht am 8. September 2021
In den Ferien kam aus Deutschland das Patenkind meiner Frau zu Besuch: ein weltoffenes, munteres Mädchen von 15 Jahren mit durch und durch positiver Lebenseinstellung. Egal, was man sie fragte – Hast du gut geschlafen? Magst du noch eine Semmel? Spielst du mit Karten? –, die Antwort lautete stets: „Alles gut!“ Auch als ihre Heimfahrt mit der Bahn sich um einen Tag verzögerte, weil ein gewisser Herr Weselsky seine Lokführer in den Streik gerufen hatte, meinte sie nur: „Alles gut!“
Wenige Tage später saßen wir, nunmehr ohne Patenkind, in der Osnabrücker Hütte am Tisch mit einem Bergwanderer aus Unterfranken. Im Lauf des Abends verließ unser Tischgenosse mehrmals seinen Platz auf der Eckbank, und damit er sich leichter täte, seine für einen Bergwanderer beachtliche Leibesfülle zwischen der Rückenlehne meines Stuhls und der Holzwand der Gaststube hindurch zu bringen, rückte ich jedes Mal mit dem Stuhl etwas nach vorn, was er immer wieder mit der Aussage quittierte: „Alles gut!“
Das musste eine neue Mode sein in Deutschland: zu erklären, dass „alles gut“ sei. In Österreich war uns dergleichen noch nicht aufgefallen. Aber in Österreich ist sowieso immer „alles gut“. Man muss es nicht immerzu bestätigen.
Die letzte Reise dieses Sommers führte uns unlängst nach Ostwestfalen, in die alte Heimat. Wir fuhren mit der Bahn, obwohl die Fahrkarten viermal so viel kosteten wie der Diesel, den unser alter Dacia auf 2000 km Hin- und Rückweg verbrennt. Für den Dacia sprach diesmal auch, dass Herr Weselsky weitere Streiks seiner Lokführer angedroht hatte. Da bucht man nicht ohne Not einen Fernzug. Aber mit einem Dacia, zumal einem alten, die deutsche Autobahn zu befahren, ist kein Spaß. Davon abgesehen denken wir oft mit Sorgen an die Umwelt und das Klima. Und Bahnfahren soll bekanntlich beides schonen.
Mit der Bahn also, trotz allem. Und die Wahl schien sich auszuzahlen. Der zweite Streik ging vorbei, und der Zug fuhr. „Alles gut“, antworteten die beiden jungen Frauen in unserem Waggon, als wir sie baten, mit uns Plätze zu tauschen, damit wir zu viert zusammensitzen könnten. „Alles gut“, sagte der Schaffner bei der Fahrkartenkontrolle, als ich ihm sagte, dass meine Tochter gerade nicht am Platz sei. Und als wir in Hannover trotz reichlicher Verspätung unseren Anschlusszug erreichten, frohlockten wir: „Alles gut!“
„Alles gut“, dachten wir uns auch, als Herr Weselsky seinen nächsten Streik ankündigte. Hatten wir doch in weiser Voraussicht unsere Rückfahrt um einen Tag vorverlegt, sodass wir gerade noch rechtzeitig vor Streikbeginn nach Österreich zurückkehren würden. Doch der ICE, der uns von Bielefeld nach Hannover bringen sollte, kam und kam nicht und fiel dann aufgrund technischer Probleme ganz aus. Der folgende ICE hatte – wegen einer „polizeilichen Ermittlung“ – so viel Verspätung, dass wir den Nachtzug nach Wien, obwohl auch der verspätet war, verpasst hätten und spätabends in Hannover gestrandet wären, kurz bevor Herrn Weselskys Streik die Bahn vollends lahmlegen würde. Also stiegen wir gar nicht erst in den ICE.
Was tun? Unser Dacia stand in Österreich. Zum Glück konnten wir uns von Verwandten ein Auto borgen. Und so verbrachte ich die Nacht statt auf einer Liege im Zug am Steuer eines Mercedes A-Klasse, in dem wir durch scheinbar endlose Baustellen, vorbei an ebenso endlosen LKW-Kolonnen zurück nach Hause fuhren. Dort kamen wir zur selben Zeit an, als wenn wir den Zug genommen hätten.
Ende gut. Alles gut?
>> nach oben
Shisha-Kohle an Bord
Veröffentlicht am 25. Juli 2021
In Spanien nennen sie es „Operación Paso del Estrecho“: Operation Querung der Meerenge. Alljährlich zu Sommerbeginn machen sich von Frankreich, Belgien und anderen westeuropäischen Ländern mehr als 3.000.000 Menschen auf die Reise, um die Ferien bei ihren Familien in Nordafrika zu verbringen. In nur wenigen Tagen ist der Transport von rund 750.000 Fahrzeugen über die Meerenge von Gibraltar zu bewältigen.
Koordiniert wird die „Operación Paso del Estrecho“ seit 1986 vom spanischen Zivilschutz. Nachdem sie 2020 wegen der Covid-Pandemie ausgefallen war, wurde sie in diesem Jahr nach einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen Marokko und Spanien abermals abgesagt. Viele Heimaturlauber in den Maghreb sind darum auf Häfen in Portugal, Frankreich oder Italien ausgewichen. Und so wurden auch wir unverhofft Teil dieser Karawane nach Süden, als wir Anfang Juli in Genua an Bord der Majestic gingen, einer Fähre der italienischen Schiffahrtsgesellschaft „Grandi Navi Veloci“.

Die 1993 in Dienst gestellte Majestic soll die Geschwindigkeit einer Fähre mit dem Komfort eines Kreuzfahrtschiffs vereinen. Sie ist 188 Meter lang, fährt im Schnitt 21 Knoten und kann 760 Autos plus 1650 Passagiere laden. Von denen hatten offenbar nur die wenigsten wie wir die Passage Genua-Barcelona gebucht. Arabisch-italienisches Stimmengewirr im Terminal (wo drei angegraute Motorradrocker aus St. Johann im Pongau, die ihre Papiere nicht in Ordnung hatten, dafür sorgten, dass schon beim Check-In die Wogen hochgingen); auf dem Kai lange Schlangen von Autos und Kleintransportern, viele mit dicken, in Plastikplanen eingepackten Bündeln auf den Dächern – all das sagte uns, dass die meisten unserer Mitreisenden wohl nach Tanger weiterfahren würden.
Stundenlang lag die Majestic mit wummernden Dieselmotoren an den Leinen, während Arbeiter in gelben Warnwesten ein Auto nach dem anderen in ihren Bauch winkten. Unterdessen füllten sich die Decks allmählich mit Männern in Tunika, Frauen mit Kopftuch, herumtollenden Kindern. Lautsprecher-Durchsagen auf Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch. In den Gängen wurden Decken und Schlafsäcke ausgerollt, in windgeschützten Ecken der Außengalerien Shisha-Pfeifen angezündet.
Und als das Schiff endlich abgelegt und Kurs auf Barcelona genommen hatte und sich über der provenzalischen Küste die Sonne senkte, Küste und Meer und Schiff in goldenen Glanz tauchend, spielte im großen Salon der Majestic eine Zwei-Mann-Kapelle auf und beschallte die Decks mit lauter marokkanischer Popmusik. Da wurde uns wieder einmal bewusst, dass das Mittelmeer seit alters Europa mit Afrika verbindet.

>> nach oben
Land der Autoholiker
Veröffentlicht am 30. Juni 2021
Kürzlich im Rathaus einer Kleinstadt am Lande, unweit von Wien: Verkehrsverhandlung. Anwesend sind die Spitzen der Lokalpolitik, Vertreter der Stadtverwaltung, der Leiter der Straßenmeisterei. Die Bezirkshauptmannschaft hat Beamte geschickt, das Land Niederösterreich einen Experten für Verkehrssicherheit und die Radlobby einen interessierten Bürger.
Die versammelten Herrschaften erörtern die Problematik einer Zufahrtsstraße, die kurvig und stellenweise so schmal ist, dass Radfahrende den motorisierten Verkehr ausbremsen und Gefahr laufen, mit selbigem in Konflikt zu geraten. Zu ihrem eigenen Wohle hat man daher bislang von allen Maßnahmen Abstand genommen, die Radler*innen womöglich zum Befahren der Straße ermuntern könnten, wie zum Beispiel ein markierter Radfahrstreifen.
Doch die Zeiten ändern sich, auch in einer kleinen Stadt am Lande. Klimawandel, Zuzug aus Wien, von Jahr zu Jahr anschwellender Auto- und Radverkehr sowie die Vorgaben der Landespolitik erzeugen vor Ort einen gewissen Handlungsdruck. Hat sich doch das Land Niederösterreich ein stolzes Ziel gesetzt: den Anteil des Radverkehrs bis 2030 von 7% auf 14% zu verdoppeln. Um es zu erreichen, wurden kühne Strategiepapiere verfasst, auf dem Reißbrett „Rad-Basisnetze“ entworfen, sogar ein „Mobility Lab“ erschaffen. Zig Fördermillionen warten nur auf ihren Abruf.
Der Bürgermeister der Stadt beauftragt also ein Verkehrsplanungsbüro, ein Konzept zu entwickeln, wie man besagte Straße für radelnde Menschen sicherer und attraktiver machen könnte. Die Verkehrsplaner wälzen Studien, erheben Daten, zeichnen Pläne. Monatelang rauchen die Köpfe. Endlich präsentieren die Planer ihren Vorschlag: An beiden Straßenrändern sollen sogenannte Mehrzweckstreifen markiert und rot eingefärbt werden. Die Streifen sind für Fahrräder, dürfen aber, wenn gerade keines dort fährt, auch von Autos benutzt werden, etwa um Gegenverkehr auszuweichen. Außerdem sieht das Konzept vor, die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h zu reduzieren.

Bild: Maurits90, CC0, via Wikimedia Commons
Das Konzept überzeugt den Bürgermeister und den Verkehrsstadtrat. Auch die Amtssachverständigen der Bezirkshauptmannschaft haben keine Bedenken, zumal die vorgeschlagene Lösung seit langem bewährter Praxis in anderen Teilen Europas, ja selbst Österreichs entspricht. Es besteht mithin gute Aussicht, dass das Konzept unbeschadet durch die Verkehrsverhandlung kommt.
Da ergreift der Experte vom Land Niederösterreich das Wort.
Zwischen den Mehrzweckstreifen bleibe eine viel zu schmale Kernfahrbahn übrig, sagt er. Da könne es zu Frontalkollisionen von Autos kommen, deren Lenker*innen womöglich nicht wagen würden, den rot gefärbten Mehrzweckstreifen zu befahren. Sowas sei ein riskantes Experiment mit unsicherem Ausgang, quasi mit den Verkehrsteilnehmern als Versuchskaninchen. Und überhaupt könne man nicht einfach so Tempo 30 verordnen. Laut StVO gelte innerorts eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Wer sie ohne stichhaltige Begründung senke, mache sich „eines Rechtsbruchs schuldig“.
Das versammelte Dutzend an Politikern, Beamten und Bürgern schweigt erschüttert. Allein der Bürgermeister wirft sich in die Bresche: Ob das Konzept nicht trotzdem eine Verbesserung bedeute gegenüber dem Status quo? Die Situation auf dieser Straße sei nicht mehr tragbar. Als Bürgermeister brauche er eine Lösung, und wenn das vorhandene „Portfolio“ keine praktikable Lösung enthalte, müsse man halt das Portfolio erweitern. Ob es denn „erst einen Toten“ brauche, damit sich etwas bewege … ?
Zwischen Bürgermeister und Experten entbrennt eine Diskussion.
Der Experte des Landes erklärt: „Irgendwas tun“ müsse man wohl, das sehe auch er so. Eine Lösung aus dem Hut zaubern könne er aber nicht. Er schlägt daher erst einmal vor, erneut den Verkehr zu messen, um „eine bessere Datengrundlage“ zu haben, und auf dieser Basis dann alternative Ideen zu erarbeiten.
Der Vorschlag des Experten wird angenommen, die Lösung auf die Zukunft vertagt.
Bis 2030 ist ja noch etwas Zeit.
Zum Lokalaugenschein etwa einen Kilometer vom Rathaus entfernt fahren natürlich alle mit dem Auto, eine Kolonne von fünf Fahrzeugen (davon zwei elektrisch). Begründung: Die eng befüllten Terminkalender ließen es nicht zu, das Rad zu nehmen. Der interessierte Bürger fährt trotzdem mit dem Fahrrad hin. Und ist als erster vor Ort.
In Niederösterreich gehen die Uhren halt anders. Zumindest in den Amtsstuben.
>> nach oben
Mit Magellan und Pigafetta (noch nicht) nach Reutlingen
Aktualisiert am 21. Juni 2021
ACHTUNG: LESUNG VERSCHOBEN!

Der gute Magellan wollte eigentlich im Herbst 1518 zu seiner Molukken-Fahrt aufbrechen. Tatsächlich in See gestochen ist er ein Jahr später, im September 1519. So war auch ich letzte Woche noch optimistisch, dass am 24. Juni eine seit langem geplante Lesung aus meinem Buch Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde und aus Antonio Pigafettas Bericht über Die Erste Reise um die Welt in der VHS Reutlingen stattfinden würde. Doch nun mussten wir die Veranstaltung leider verschieben – im Verschieben sind wir inzwischen Routiniers – und zwar auf den 10. März 2022. Also bitte vormerken für nächstes Frühjahr!
Stefan Zweig in der Diskussion
Am 16. Juni habe ich im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek mit Arnhilt Inguglia-Höfle, Bernhard Fetz und Arturo Larcati über den Autor Stefan Zweig und seine Welt diskutiert. Maria Happel hat Texte von Stefan Zweig vorgelesen. Ich fand es sehr anregend, mit ausgewiesenen Fachleuten über einen Schriftsteller zu sprechen, der bis heute mit seinen Werken – nicht zuletzt dem Roman Magellan – das Bild prägt, das sich viele Menschen von der Geschichte machen. Interessierte können die Diskussion hier oder auch hier nachverfolgen.
Quantitative Rezensionsmethoden?
 Eines der wichtigsten deutschsprachigen Rezensionsjournale für die Geschichtswissenschaft, die „Sehepunkte“, hat meine Pigafetta-Neuübersetzung mit einer Besprechung gewürdigt. Das freut mich natürlich außerordentlich. Aber ich musste mich auch wundern, nach welchen Kriterien dort Bücher rezensiert werden. Um zu überprüfen, ob meine Übersetzung tatsächlich die erste vollständige (und originalgetreue) in deutscher Sprache sei, hat der Rezensent sich doch tatsächlich die Mühe gemacht, die Seitenzahlen der älteren Ausgaben von Pigafettas Text mit dem Umfang meiner Neuübersetzung zu vergleichen! Und nachdem er festgestellt hat, dass jene mehr Seiten haben, „erscheint es“ ihm „unwahrscheinlich, dass die beiden letzteren größere Teile der Originaltexte ausgelassen haben“. Na denn! So ganz dürfte der Rezensent seinen quantitativen Methoden allerdings selbst nicht trauen, denn er räumt ein: „Es kann durchaus sein, dass Jostmanns Übersetzung textgetreuer ist.“
Eines der wichtigsten deutschsprachigen Rezensionsjournale für die Geschichtswissenschaft, die „Sehepunkte“, hat meine Pigafetta-Neuübersetzung mit einer Besprechung gewürdigt. Das freut mich natürlich außerordentlich. Aber ich musste mich auch wundern, nach welchen Kriterien dort Bücher rezensiert werden. Um zu überprüfen, ob meine Übersetzung tatsächlich die erste vollständige (und originalgetreue) in deutscher Sprache sei, hat der Rezensent sich doch tatsächlich die Mühe gemacht, die Seitenzahlen der älteren Ausgaben von Pigafettas Text mit dem Umfang meiner Neuübersetzung zu vergleichen! Und nachdem er festgestellt hat, dass jene mehr Seiten haben, „erscheint es“ ihm „unwahrscheinlich, dass die beiden letzteren größere Teile der Originaltexte ausgelassen haben“. Na denn! So ganz dürfte der Rezensent seinen quantitativen Methoden allerdings selbst nicht trauen, denn er räumt ein: „Es kann durchaus sein, dass Jostmanns Übersetzung textgetreuer ist.“
>> nach oben
Hitler, Magellan und Stefan Zweig
Veröffentlicht am 21. Mai 2021
Weltverbrecher

Diese Woche ist in der österreichischen Wochenzeitung „Die Furche“ meine Rezension von Roman Sandgrubers Buch „Hitlers Vater. Wie der Sohn zum Diktator wurde“ zu lesen: vordergründig eine Biografie des Zollamt-Oberoffizials Alois Hitler geb. Schicklgruber, de facto jedoch eine sachkundige Sozialgeschichte Oberösterreichs an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert, die mit einigen Mythen um Herkunft und Kindheit des späteren Reichskanzlers und „Führers“ aufräumt.
Welterkunder

Aus Anlass von Ferdinand Magellans 500. Todestag am 27. April 2021 hat Andrea Lueg über den „Pionier der Globalisierung“ ein höchst hörenswertes Radiofeature produziert, zu dem ich ein Interview beisteuern durfte. Es wurde auf SWR2 ausgestrahlt und kann hier nachgehört werden.
Weltautor
 Am 16. Juni diskutiere ich im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek mit Bernhard Fetz und Arturo Larcati über Stefan Zweig und seinen „Magellan“. Der 1938 erschienene Roman ist nicht nur eines der weltweit meistgelesenen Bücher über den portugiesischen Seefahrer, sondern auch voll von rassistischen Stereotypen. Die Diskussion wird per Live-Stream im Internet übertragen.
Am 16. Juni diskutiere ich im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek mit Bernhard Fetz und Arturo Larcati über Stefan Zweig und seinen „Magellan“. Der 1938 erschienene Roman ist nicht nur eines der weltweit meistgelesenen Bücher über den portugiesischen Seefahrer, sondern auch voll von rassistischen Stereotypen. Die Diskussion wird per Live-Stream im Internet übertragen.
>> nach oben
Wunder für die Augen: Islamische Weltkarten
Veröffentlicht am 26. April 2021
Es soll noch heute Menschen geben, die glauben oder behaupten, die Erde sei eine flache Scheibe – eine Vorstellung, die fälschlicherweise oft pauschal dem Mittelalter in die Holzpantinen geschoben wird. In Wahrheit geriet die antike Theorie einer sphärenförmigen Erde nie in Vergessenheit. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert war sie in Europa allgemeines Bildungsgut, zumindest in Kreisen, die sich für solche Dinge interessierten, das heißt vor allem unter Theologen und Seefahrern.

Bild: Kimon Berlin, user:Gribeco, via Wikimedia Commons
Eine andere Frage war allerdings, wie man sich die Erdoberfläche im ganzen vorzustellen hatte, wie Land und Wasser auf ihr verteilt waren. Sich davon ein Bild zu machen, war naturgemäß schwierig in einer Welt, in der es keine Fluggeräte, geschweige denn Erdbeobachtungssatelliten gab und Reisende an Land im Schnitt 30 bis 40, zur See günstigenfalls 150 Kilometer pro Tag zurücklegten. Deshalb staune ich immer wieder darüber, wie sich seit dem späten Mittelalter auf Landkarten ein neues Bild der Erde abzeichnet, auf dem Strich für Strich die Kontinente Konturen gewinnen – Konturen von atemberaubender Gegenständlichkeit, obwohl den Zeichnern ihr Objekt niemals vor Augen stand. Welchen geistigen Kraftakts, welcher Imaginationskraft es dafür bedurfte, ist für die meisten von uns heute kaum zu ermessen.
Die allmähliche Verfertigung eines neuen Weltbilds beim Zeichnen ist keine rein europäische Geschichte. Welchen Beitrag muslimische Gelehrte dazu geleistet haben, ist seit langem bekannt. Muslime wirkten nicht nur als Vermittler geographischen und mathematischen Wissens, sondern ragten auch als Kartografen hervor. So sind wohl allen, die sich für die Geschichte der Kartografie interessieren, die Weltkarten des al-Idrīsī (1154) und des Pīrī Re’īs (1513, Fragment) ein Begriff. Man findet sie zuhauf in Büchern und im Internet abgebildet.
Doch die Karten von al-Idrīsī und Pīrī Re’īs sind prominente Einzelstücke. Sie sind Teil einer reichen Tradition, hervorgebracht von muslimischen Kartenzeichnern des Mittelalters, deren Namen und Werke hierzulande nur den wenigsten bekannt sein dürften. Dass es jedoch lohnt, dieser Tradition Augenmerk zu schenken, beweist der Band „Islamische Karten“ des Londoner Historikers Yossef Rapoport. So wie andere Forscher*innen heute sieht auch Rapoport in den Werken muslimischer Kartenzeichner nicht mehr bloße Zwischenschritte auf dem Weg hin zum modernen Weltbild, sondern einzigartige Schöpfungen des menschlichen Geistes, die ein Studium um ihrer selbst willen verdienen.

Bild: Wikimedia Commons
Ist der Maßstab für die Qualität einer modernen Karte ihre Gegenständlichkeit, das heißt, wie akkurat, wirklichkeits- und detailgetreu sie die Erdoberfläche darstellt, so verfolgten muslimische Kartografen andere Absichten. Ihnen ging es darum – in Rapoports Worten –, „ein kompliziertes Material zu ordnen“ und damit das Gedächtnis zu entlasten. Die Methode, die sie dafür wählten, war die schematische Darstellung, die geometrische Vereinfachung, die radikale Abstraktion. Ihre Karten waren nicht Ausdruck gelehrter oder theologischer Spekulation, sondern praktisch zu gebrauchende Werkzeuge, die Fernhändlern und Pilgern geholfen haben mögen, ihre Reiserouten zu planen. Man kann sie mit heutigen U-Bahn-Plänen vergleichen, die ein Verkehrsnetz geometrisch stark vereinfacht abbilden und gerade so dem Fahrgast die Orientierung ermöglichen.
Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die Weltkarte, die 1272 nach einem Entwurf des Geografen Abū Isḥāq al-Iṣṭakhrī gezeichnet wurde, dann muss man die Eleganz und Kühnheit dieses Entwurfs würdigen. Über al-Iṣṭakhrī weiß man nur, dass er wohl aus dem Iran stammte, in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts tätig war und einen geographischen Traktat mit Karten hinterließ, der ein eigenes literatisches Genre begründen sollte: das „Buch der Wege und Reiche“ (Kitāb al-masālik wa’l-mamālik). Seine zwanzig Regionalkarten ergeben laut Rapoport „einen regelrechten Atlas des Islam“. Die Weltkarte, die al-Iṣṭakhrī dazu zeichnete, sollte den Lesern seines Buchs helfen, die einzelnen Regionen auf der Erde und in ihrem Verhältnis zueinander zu verorten.

Süden mit Afrika liegt oben, durchschnitten vom schnurgeraden Nil und von Asien (links unten) durch den Indischen Ozean getrennt. Die Arabische Halbinsel fungiert als Verbindung, während Europa klein und schematisch als dreieckige Insel dargestellt ist, durch das Schwarze und das Mittelmeer vom Rest der Welt separiert. Die drei roten Kreise im Mittelmeer sind die Inseln Zypern, Kreta und Sizilien. Die gesamte alte Welt erscheint eingebettet in das „Umzingelnde Meer“ (Baḥr al-Muḥīṭ), von dem al-Iṣṭakhrī „wie alle mittelalterlichen Gelehrten vor Kolumbus“ (Rapoport) annahm, dass es auch die Rückseite der Erdkugel bedeckte.
[Die kreisförmige Darstellungsform, die typisch ist für vormoderne Weltkarten, kam jüngst übrigens wieder zu Ehren als realistischste mögliche Darstellung einer sphärischen Oberfläche auf einer zweidimensionalen Karte. Nicht nur deswegen mutet ihr Design erfrischend aktuell an.]

Ein Beispiel für die Regionalkarten in al-Iṣṭakhrīs „Buch der Wege und Reiche“ ist die des muslimischen Spanien und Nordafrikas. Hier ist Westen oben, also der Atlantik. Spanien ist als Halbkreis dargestellt, von den christlichen Reichen im Norden durch eine Linie abgetrennt. Sie liegen außerhalb der Karte. Achteckig in der Mitte des Halbkreises sitzt die Metropole Córdoba, von der aus Straßen in die verschiedenen Richtungen gehen. Entlang der Küsten sind weitere Städte aufgereiht, im Hinterland Nordafrikas (links) verläuft eine Straße, und ganz am linken Rand, also im Süden, ist purpurn der Sand der Sahara eingezeichnet. Der rote Kreis unten im grünen Mittelmeer ist Sizilien, der lila Berg darüber steht für den Felsen von Gibraltar. Wie gesagt: Der Zeichner wollte kein wirklichkeitsgetreues Abbild des westlichen Mittelmeeres schaffen, sondern ein Netz aus Verbindungen zwischen von Muslimen bewohnten Orten visualisieren. Und seine Karte war in erster Linie für Reisende an Land gedacht, nicht für Seefahrer.
Auf die Spitze getrieben wird die Abstraktion im „Buch der Merkwürdigkeiten der Wissenschaften und der Wunder für die Augen“ (Kitab al-gharāʾib al-funūn wa-mulaḥ al-ʿuyūn), das ein anonymer Autor irgendwann vor 1058 für die Herrscher der Fatimiden-Dynastie verfasste. Es wurde im Jahr 2000 bei einer Auktion in London wiederentdeckt und ist heute im Besitz der Bodleian Library in Oxford. Die Fatimiden beherrschten von Kairo aus weite Teile Nordafrikas, die Levante und Sizilien. Ihr Reich war zum Meer ausgerichtet und gründete sich auf Seemacht, was sich auch im „Buch der Merkwürdigkeiten“ widerspiegelt.
Darin findet sich etwa eine Karte, auf der das Mittelmeer als langgestrecktes Oval konzipiert ist. Der tatsächliche Küstenverlauf ist nicht einmal angedeutet. Entlang der Küste sind punktförmig 121 Häfen und Reeden aufgereiht. Im Meer liegen regelmäßig angeordnet 118 Inseln, die meisten schlicht als Kreise; nur Zypern und Sizilien bilden Rechtecke. Eine Detailkarte von Zypern ist ebenfalls vollkommen rechteckig. Wie Rapoport erklärt, enthalten diese extrem schematischen Karten in ihren Begleittexten dennoch eine Menge an Information, die für die Navigation von Belang war – „mehr als jede andere Karte, die wir vor der Zeit der Kreuzzüge kennen“.

Das „Buch der Merkwürdigkeiten“ birgt auch eine Weltkarte, die erste überhaupt in der Menschheits-Geschichte, die mit einem Maßstab versehen ist. Man sieht ihn oben rechts. Die Karte ist rechteckig und stellt nur den Teil der Welt dar, von dem der Autor wusste, dass er bewohnt war. Sonst ist die Anordnung dieselbe wie auf al-Iṣṭakhrīs Weltkarte: Süden ist oben, Europa unten rechts, Asien links. Der braune Halbkreis oben in der Mitte sind die legendären Mondberge, in denen schon Ptolemäus die Quellen des Nils verortet hatte. Wieder stehen rote Punkte für Häfen und Städte. Dazwischen sehen wir Flüsse, Gebirge und links unten eine Mauer: Hinter ihr sollen der Beschriftung zufolge die Völker Gog und Magog eingesperrt sein, die auch der christlichen Apokalyptik bekannt waren und von denen man annahm, dass sie am Ende der Zeiten über die Welt herfallen würden.
„Islamische Karten“ von Yossef Rapoport öffnet den Blick für eine fremde und ferne, zugleich seltsam vertraute Welt. Es ist ein in jeder Hinsicht illustratives Buch: großzügig bebildert, anschaulich geschrieben, und bietet eine gut lesbare, längst überfällige Einführung in die faszinierende Geschichte der islamischen Kartografie.
Zu guter Letzt ein Disclaimer: Rapoports Buch ist im selben Verlag erschienen wie meine Pigafetta-Neuübersetzung. Ich habe vom Verlag kein Rezensionsexemplar erhalten, sondern das Buch selbst käuflich erworben. Da ich von der Lektüre angetan war, stelle ich es auf meiner privaten Internet-Seite vor. Die Bilder hat mir die wbg auf Anfrage freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
>> nach oben
Frosch oder Vogel?
Veröffentlicht am 19. April 2021
Die gute alte Landkarte ist aus der Mode gekommen. Ich kenne etliche Leute, die auch auf längeren Wanderungen keine mehr in den Rucksack packen. Sie verlassen sich blind auf ihr Smartphone. Den Blick konzentriert aufs Display gerichtet marschieren sie zielstrebig und von Zweifeln unangefochten über Stock und Stein.
Doch selbst wenn ich ein Smartphone besäße, ohne gescheite Landkarte ginge ich ungern ins Gelände – es sei denn, ich kennte die Gegend wie meine Westentasche. Dass man gedruckte Karten bei Tageslicht ohne elektrischen Strom lesen kann, ist noch ihr geringster (wenn auch keineswegs gering zu schätzender) Vorzug. Weit höher achte ich, dass eine Karte dem Geist Flügel verleiht. Sie verwandelt mich von einem Frosch in einen Vogel. In der Theorie kann ein Smartphone zwar dasselbe. Aber weil sein Display so klein ist, macht es uns praktisch zu ferngesteuerten Fröschen.
>> nach oben
Zeichen der Zeit
Veröffentlicht am 20. März 2021
Dieses Foto wurde heute vormittag ca. 25 Kilometer nördlich von Wien aufgenommen, knapp vor dem astronomischen Frühlingsanfang um 10:37 Uhr MEZ:

Was es sonst noch Neues gibt?
Meine Neu-Übersetzung von Antonio Pigafettas Weltreisebericht, die seit Weihnachten vergriffen bzw. nur als „Book on Demand“ erhältlich war, ist endlich wieder lieferbar. Für alle, die es noch nicht wissen: Es ist die erste vollständige, orignalgetreue und farbig illustrierte deutsche Übersetzung dieses überaus lesenswerten Buches aus dem Jahr 1524.
Und am Dienstag, den 16. März 2021, jährte sich zum 500. Mal der Tag, an dem europäische Seefahrer erstmals der heutigen Philippinen ansichtig wurden. Daniela Wakonigg hat aus dem Anlass für den WDR ein so stimmungsvolles wie nachdenklich stimmendes „Zeitzeichen“ produziert, zu dem ich ein Interview beisteuern durfte: hier nachzuhören.
>> nach oben
Dieses Spiel geht nur zu zweit
Veröffentlicht am 8. März 2021
Heute ist der Tag, an dem eine gewisse sprachliche Unterscheidung große Beachtung findet: die von „Frau“ und „Mann“. Sie wird im Diskurs, jedenfalls seit dem 19. Jahrhundert, vielfach als sozialer Antagonismus verhandelt, der sich mit einem Modell der Spieltheorie als Kampf der Geschlechter oder auch, unter Rückgriff auf Hegel, als Dialektik von Magd und Herr beschreiben lässt. Beides hat viel für sich, aber heute will ich einen anderen Zugang zu diesem Thema wählen.
Nach einer Denkfigur von Niklas Luhmann (die Luhmann wiederum dem Logiker George Spencer Brown abgeschaut hat) kann jegliche Unterscheidung in einem zweiten Schritt auf die eine Seite des Unterschiedenen angewendet werden. Luhmann nennt diese Operation (wiederum mit George Spencer Brown) „re-entry“. Im Fall der Unterscheidung „Frau/Mann“ hieße das, dass die als Frau oder Mann markierten Personen ihrerseits im Hinblick auf ihre weiblichen oder männlichen Seiten unterschieden werden können. Mit anderen Worten, eine Beobachterin kann eine Frau als ausgesprochen feminin oder im Gegenteil als maskulin beschreiben und ebenso einen Mann als effeminiert oder eben viril.
Betrachte ich den aktuellen Diskurs um die Rollen von Frau und Mann unter der Figur des „re-entry“, nehme ich vorherrschend eine (oft unausgesprochene) normative Präferenz für die männliche Seite der Unterscheidung wahr. Wer die Gleichstellung der Frau fordert, meint in der Regel den Zugang von Frauen zu sozialen Rollen, die bis vor wenigen Generationen Männern vorbehalten waren: Rollen, die vor allem der sogenannten Arbeitswelt zuzordnen sind, und innerhalb dieser insbesondere Führungsrollen. Frauen, so wird implizit angenommen, wollen und sollen wie Männer Karriere machen und deren Rollen besetzen. Sie sollen mit Männern – und anderen Frauen – um Erfolg, Prestige, Einfluss, Geld, kurzum sozialen Status konkurrieren.
So sehr ich (im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten) die Forderung nach Gleichstellung unterstütze, so einseitig finde ich sie. Zugespitzt formuliert läuft der Diskurs darauf hinaus, dass Frauen möglichst wie Männer werden sollen und dass die Gesellschaft ihnen diese Möglichkeit einzuräumen habe. Traditionell weiblich definierte Rollen wie insbesondere das Aufziehen von Kindern und, damit räumlich verbunden, die Sorge für den Haushalt erscheinen dabei vorwiegend als lästiges Hindernis für die beruflichen Karrieren von Frauen, das ausgeräumt werden muss.

Gelingen soll das a) durch technische Errungenschaften, die die Hausarbeit (oft nur scheinbar) erleichtern (und de facto oft vermehren, weil sie Perfektionsansprüche fördern), b) durch die Auslagerung häuslicher Arbeit, sofern möglich, an sozial schwächere Menschen (also in den meisten Fällen wieder an Frauen), oder c) indem die männlichen Partner einen größeren Anteil an besagter Arbeit übernehmen. Männer, die nicht imstande sind, ihre Frauen durch Methode a) oder b) zu entlasten und daher selbst Hausarbeit und Kinderbetreuung leisten müssen, erleiden nach der Spieltheorie einen Verlust, weil sie ein gesellschaftlich höher bewertetes, „männliches“ Gut – beruflichen Erfolg – gegen ein geringerwertiges, „weibliches“ eintauschen müssen.
Als unsere Tochter auf die Welt kam, hatte auch ich das skizzierte Werteschema im Kopf, und als liberaler und fortschrittlicher Mann, der ich mich dünkte, war ich bereit, meinen Beitrag zu leisten, damit meine hochintelligente, gut ausgebildete Frau möglichst rasch nach der Geburt in ihren Beruf zurückkehren konnte. Meine Frau und ich waren uns daher einig, die Betreuung unserer Tochter während der ersten Lebensjahre so aufzuteilen, dass in Summe jede von uns in etwa die Hälfte übernehmen würde. Im Großen und Ganzen, denke ich, ist die Rechnung für uns beide aufgegangen, auch seitdem einige Jahre später ein Sohn dazugekommen ist. Was sich jedoch im Lauf der Zeit geändert hat, ist unsere Motivation.
Ging es vor allem mir anfangs darum, meiner Frau den Rücken für ihre berufliche Selbstverwirklichung freizuhalten, so empfinde ich es heute als Glück für mich, dass ich so viel Verantwortung für die Kinder übernehmen, so viel Zeit mit ihnen verbringen durfte und – in altersbedingt abnehmendem Umfang – noch darf. Meine Kinder haben mich gelehrt, die Welt mit anderen Augen zu sehen, und sie haben mir selbst quasi eine zweite Kindheit ermöglicht, ein emotionales Abenteuer, das meine Persönlichkeit verändert hat in einer Weise, die ich als Befreiung und Bereicherung erlebe. Sie ließe sich mit Luhmann und George Spencer Brown als „re-entry“ des Weiblichen in mein männlich sozialisiertes Ego beschreiben.
Aus dieser Erfahrung heraus bemängele ich, dass im Diskurs um die Befreiung der Frau die männliche Seite der Unterscheidung dominiert. Frauen sollen noch immer frei werden von Kindern und Haushalt und für die Männerwelt bezahlter Arbeit, auf dass sie in ihr Karriere machen und viel Geld verdienen, Männer wiederum ihre Plätze freimachen und lernen, sich mit einem geringeren gesellschaftlichen Status zu bescheiden, wie er weiblichen Rollen zugemessen wird. Die Gleichstellung der Frau erscheint so als Nullsummenspiel. Dabei geht es für uns Männer gar nicht darum, etwas zu verlieren, sondern zu gewinnen. Daran möchte ich am Weltfrauentag erinnern.
>> nach oben
Skifoan!
Veröffentlicht am 22. Februar 2021
Wer Anfang der siebziger Jahre in Norddeutschland zur Welt kam, dem wurden die Ski nicht in die Wiege gelegt, schon gar nicht in der Gesellschaftsschicht, in die ich geboren wurde. Die Alpen waren weit weg, und Winterurlaub war teuer. Unbelastet von eigenen Erfahrungen mit dieser Sportart konnte ich mir also in aller Ruhe eine Meinung über sie bilden, welche lautete: Skifahren ist nichts für mich! Ich stellte mir darunter so etwas wie Eislaufen vor, nur viel grauslicher, weil man beim Skifahren nicht bloß auf wackligen Sohlen unwillkürlich in irgendeine Richtung schlitterte und dann hinfiel, sondern das ganze auch noch bergab.
Dann kam der Tag, da ich in eine österreichische Familie einheiratete und die Eltern meiner Frau uns in den Skiurlaub einluden. Die Einladung auszuschlagen, wäre unhöflich gewesen. Und obwohl ich fand, mit über dreißig viel zu alt zu sein, erklärte ich mich bereit, einen Tag mit meiner Schwiegermutter – die als Lehrerin etliche Schulskikurse begleitet hatte – auf den „Deppenhügel“ zu gehen, um mich in den Grundlagen des alpinen Skilaufs unterweisen zu lassen. Insgeheim gedachte ich im Laufe des Tages meine Untauglichkeit zu diesem Sport so gründlich unter Beweis zu stellen, dass nie wieder jemand auf die Idee käme, mich dazu ermuntern zu wollen.
Was gute Pädagogik doch bewirken kann …
Am nächsten Nachmittag fuhr ich bereits, wenn auch hauptsächlich zur Belustigung – oder Verärgerung – der übrigen Skifahrer, meine erste „rote“ Piste hinab, und aus dem Urlaub heimgekehrt war das erste, was ich tat, beim Alpenverein einen „Tiefschnee-Schnupperkurs“ zu buchen. Der Kurs trug seinen Namen völlig zu Recht – jedenfalls was mich betraf, denn die meiste Zeit lag ich mit der Nase im Schnee. Meiner Begeisterung tat das keinen Abbruch. Sie hält bis heute an, obwohl ich den Rummel der großen Skigebiete schon lange leid bin, ebenso wie die bretthart präparierten Kunstschnee-Pisten und die horrenden Preise, die man für eine Liftkarte zahlt. Aber eine gemächliche Skitour durch die stille Landschaft, ein paar beherzte Schwünge durch Pulver oder Firn – was gäbe es Schöneres zur Winterzeit!
 Auf die Piste gehen wir auch noch ab und an, hauptsächlich der Kinder wegen, damit sie an die frische Luft kommen und sich bewegen, was uns in diesem Winter noch dringlicher erscheint als sonst, wo doch alle Sportvereine, alle Schwimmbäder und Turnhallen stillgelegt sind. Von den skandalösen Zuständen, über die in den Medien berichtet wurde, haben wir in den Skigebieten im Osten Österreichs allerdings nichts bemerkt. Auch wenn zum Teil einiges los war: Die Liftbetreiber hatten Regeln für einen sicheren Betrieb festgelegt und sorgten, sofern nötig, für deren Einhaltung. Die allermeisten Leute hielten eh Abstand und trugen Masken. Statt einer heißen „Supp‘n“ zu Mittag und beschallter Hüttengaudi gab es geschmierte Brote und Tee aus der Thermoskanne am Parkplatz. Und dann hieß es wieder „nix wie aufi“!
Auf die Piste gehen wir auch noch ab und an, hauptsächlich der Kinder wegen, damit sie an die frische Luft kommen und sich bewegen, was uns in diesem Winter noch dringlicher erscheint als sonst, wo doch alle Sportvereine, alle Schwimmbäder und Turnhallen stillgelegt sind. Von den skandalösen Zuständen, über die in den Medien berichtet wurde, haben wir in den Skigebieten im Osten Österreichs allerdings nichts bemerkt. Auch wenn zum Teil einiges los war: Die Liftbetreiber hatten Regeln für einen sicheren Betrieb festgelegt und sorgten, sofern nötig, für deren Einhaltung. Die allermeisten Leute hielten eh Abstand und trugen Masken. Statt einer heißen „Supp‘n“ zu Mittag und beschallter Hüttengaudi gab es geschmierte Brote und Tee aus der Thermoskanne am Parkplatz. Und dann hieß es wieder „nix wie aufi“!
>> nach oben
Hauptsache gesund
Aktualisiert am 22. Februar 2021
Es ist eine Weile her, da las ich in der Zeitung ein Interview mit dem vormaligen Chef einer der größten österreichischen Banken. Nach Jahrzehnten verantwortungsvoller Tätigkeit an der Spitze seines Instituts war der Mann kürzlich in Pension gegangen und wollte sich nun dem Aufbau einer Stiftung widmen, die den löblichen Zweck hat, das allgemeine Niveau finanzieller und kaufmännischer Bildung zu heben. Diese lasse nicht nur in Österreich zu wünschen übrig, klagte der Interviewte und setzte hinzu: „Denn finanzielle Gesundheit“ sei „nach der physischen Gesundheit das Zweitwichtigste.“
So ist das also, dachte ich mir damals: Wenn einer nicht alle Tassen im Schrank hat, ist das anscheinend halb so wild, solange nur seine Leber gesund und sein Bankkonto gut gefüllt ist. Geistige oder psychische Gesundheit, um von seelischer gar nicht zu reden, schien für diesen Herrn kein nennenswertes Gut zu sein. Und ich fragte mich, ob sein Denken repräsentativ sei für Menschen seines Schlages, die als Führer der größten Firmen des Landes maßgeblichen Einfluss auf den Kurs der österreichischen Wirtschaft, ja der Gesellschaft insgesamt ausüben.
Heute neige ich dazu, diese Frage zu bejahen. Schaue ich mir nämlich an, nach welchen Prioritäten hierzulande, aber auch anderswo der Kampf gegen das Coronavirus geführt wird, so habe ich den Eindruck, dass es in diesem Kampf nur darum geht, das physische Überleben der Bevölkerung zu sichern und die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Dafür stehen scheinbar unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Bildung, Kultur, überhaupt alles, was sonst Menschen geistig und psychisch stärkt, spielt dagegen so gut wie keine Rolle. Schulen werden zu- und Heranwachsende monatelang zu Hause eingesperrt, ohne Rücksicht auf die langfristigen Folgen. Sportvereine lahmgelegt. Kinos, Theater, Bibliotheken, Museen und Konzertsäle verschlossen. Familien voneinander getrennt, Alte abgesondert und Sterbende allein gelassen.
Nein, auch ich habe keine Patentlösung parat. Aber je mehr die „Krise“ zum Normalzustand wird, desto deutlicher erkenne ich, was in unserer Gesellschaft wirklich von Belang ist. Kinder, ihre Zukunft, Bildung, Kultur und überhaupt das innere Glück der Menschen zählen offensichtlich nicht dazu. Es offenbart sich das Menschenbild einer Politik, die die Stimmungen der breiten Masse und die Interessen einer kleinen Minderheit bedient.
>> nach oben
Pigafetta im Radio
Veröffentlicht am 12. Januar 2021

Thomas Haunschmid hat für den österreichischen Kultursender Ö1 eine Besprechung meiner Neuübersetzung von Antonio Pigafettas Weltreisebericht produziert:
Bereits im Dezember ist eine Besprechung von Frank Kaspar im Deutschlandfunk gesendet worden, die ich ebenfalls sehr gelungen finde:
Da die erste Auflage des Buches schon ausverkauft ist, kann man es zur Zeit nur als Book on Demand oder eBook erwerben. Wie mir jedoch versichert wurde, ist eine Neuauflage in Vorbereitung.
Die erste Reise um die Welt. An Bord mit Magellan
>> nach oben
Maßloses Wünschen
Veröffentlicht am 22. Dezember 2020
Wir können den Kindern nicht alle Wünsche erfüllen, auch nicht zu Weihnachten. Sie werden heuer wieder keinen Hund bekommen, obwohl ein Vierbeiner ganz oben auf beider Wunschzettel stand. Auch ein anderer Wunsch wird leider nicht in Erfüllung gehen: weiße Weihnachten. Aber das ist ja nichts Neues. Außerdem haben unsere Kinder das Alter magischen Denkens und des Glaubens an die grenzenlose Macht der Eltern längst hinter sich gelassen. Neu ist allerdings, dass ein weiterer Herzenswunsch, der sonst zum Jahreswechsel wahr zu werden pflegt, diesmal unerfüllt bleiben muss: die Großeltern und Cousins im fernen Deutschland wiederzusehen. Das heißt, Sehen wäre ja nicht das Problem, dank Zoom, Skype & Co. Aber wie die Tochter sagt: Das ist nicht dasselbe. Sie hat recht, finde ich.
Es folgt ein Bekenntnis:
Ich bin kein Corona-Leugner. Ich trage keinen Aluhut und fürchte nicht, dass ein philantropischer Milliardär aus Seattle uns alle zwangsimpfen will. Ich halte es für sinnvoll und ethisch richtig, dass eine Gesellschaft koordinierte Anstrengungen unternimmt, um eine Infektionskrankheit einzudämmen, die das Leben und die Gesundheit vieler Menschen bedroht. Auch wenn wir uns um unsertwillen nicht vor dem Coronavirus fürchten, tragen meine Frau, unsere Kinder und ich bisher alle verordneten Maßnahmen klaglos mit. Wir tragen also in der Öffentlichkeit MNS-Masken, halten Abstand zu anderen Menschen, bleiben die meiste Zeit zuhause, empfangen keinen Besuch mehr, organisieren, wenn die Schulen wieder mal zusperren, den Heimunterrricht, sind zum Massentest gegangen, achten noch mehr als sonst darauf, uns nicht zu verletzen, um ja keine Spitalskapazitäten zu binden, tun im Übrigen unsere Arbeit und geben fleißig Geld aus, damit die Wirtschaft nicht den Bach runtergeht.
Manche sagen, so ein Leben, wie wir es jetzt führen, sei kein Leben mehr. Das finde ich übertrieben. Reduktion, richtig verstanden, ist immer auch Gewinn, und solange es Bücher gibt und man, wie wir, nach draußen gehen kann, kann vom Ende des Lebens keine Rede sein. Aber auch an mir nagen zunehmend Zweifel, ob die im Wochentakt verordneten Maßnahmen noch in einem angemessenen Verhältnis zum Ausmaß der Gefahr stehen, dem wir als Gesellschaft – nicht als Individuen – ausgesetzt sind. Ich frage mich, ob unsere Ängste auf der einen Seite und auf der anderen der Wunsch, alle Gefahren und Fährnisse des Lebens kontrollieren oder gar ausschließen zu können, nicht eine unheilige Allianz eingegangen sind. Als ich neulich jemandem erzählte, meine Frau und ich seien mit zwei anderen Menschen, die nicht in unserem Haushalt leben, im Wald spazieren gewesen, wurde ich ernsthaft gefragt, ob wir das denn „verantworten“ könnten …
In der Weihnachtsgeschichte kommt dieser Satz vor, den der Engel zu den Hirten spricht: Fürchtet euch nicht! Das ist leicht gesagt, vor allem, wenn man ein Engel ist. Dennoch weckt der Satz einen Wunsch in mir, von dem ich allerdings nicht weiß, wer ihn mir erfüllen kann. Ich wünsche mir, dass wir alle uns im neuen Jahr weniger von unseren Ängsten regieren lassen.
>> nach oben
Weiße Götter, braune Naturkinder
Kritische Anmerkungen zu Stefan Zweigs biografischem Roman Magellan. Der Mann und seine Tat
Veröffentlicht am 26. November 2020
Als ich dem Verlag C.H. Beck im Frühjahr 2016 vorschlug, ein Buch über Magellan und die erste historisch bezeugte Weltumrundung zu machen, ahnte ich nicht, dass mich der Mann und die Taten, die ihm nachgesagt werden, fast fünf Jahre später noch beschäftigen würden. Das Buch, das pünktlich zum 500. Jahrestag von Magellans Aufbruch Richtung Ostasien 2019 herauskam, ist inzwischen in dritter Auflage erhältlich und in seinem Kielwasser segelt seit vergangenem September ein weiteres: meine Neu-Übersetzung des Reiseberichts von Antonio Pigafetta, die erste vollständige und originalgetreue Übersetzung dieses höchst lesenswerten Textes in die deutsche Sprache. Anscheinend bewegen die Abenteuer frühneuzeitlicher Seefahrer auch die Menschen des 21. Jahrhunderts – und bewegen sie sogar dazu, Bücher zu verlegen und zu lesen!

Bild: Brazilian National Archives, Public domain, via Wikimedia Commons
Aber welche Bücher? Im Zuge meiner Recherchen für das Magellan-Buch las ich natürlich auch Stefan Zweigs romanhafte Darstellung des Stoffes aus den 1930er Jahren, abermals nicht ahnend, dass auch dieser Mann und seine schriftstellerische Tat mich noch Jahre später geistig in Beschlag nehmen würden. Vor allem war mir nicht bewusst, wie sehr die literarische Figur Magellan, die Stefan Zweig erschaffen hat, bis heute das Bild prägt, das sich viele Menschen von der historischen Person machen, die dahinter steht: dem portugiesischen Ritter Fernão de Magalhães.
Nun ist die Unterscheidung von Literatur und Geschichte eine künstliche und unscharfe. Die Grenzen zwischen beiden Genres sind fließend. Das kann man sehr gut an Zweigs Magellan und der Rezeption seines Buchs studieren. Zweig hatte seinen Stoff gründlich recherchiert, und die äußere Handlung seiner Erzählung entspricht weitgehend dem, was zu seiner Zeit in der nicht-fiktiven Literatur – also in dem, was wir heute Sachbücher nennen – über Magellan und die erste Erdumsegelung nachzulesen war. In der Einleitung erklärte Zweig ausdrücklich, er habe Magellans Geschichte „nach allen erreichbaren Dokumenten möglichst der Wirklichkeit getreu“ dargestellt. Seine Leserinnen und Leser könnten daher auf die Idee kommen, ein literarisch geschriebenes Sachbuch („literary non-fiction“) in den Händen zu halten, das den Maßstäben historischer Kritik standhält und ein realistisches Bild der erzählten Zeit, der Welt des 16. Jahrhunderts, zeichnet. Doch das ist mitnichten der Fall.

Bild: Crispijn van de Passe, Public domain, via Wikimedia Commons
Aus der Sicht historischer Wissenschaft, zumal des 21. Jahrhunderts, ist Zweigs Magellan ein durch und durch anachronistischer Text. Während die äußere Handlung im 16. Jahrhundert spielt und die meisten der geschilderten Ereignisse durch historische Quellen verbürgt sind, sind Zweigs Aussagen über die Psyche seines Helden und das, was man sein inneres Drama nennen kann, pure Fiktion. Dasselbe gilt für viele kausale Zuschreibungen, die der Autor vornimmt, das heißt seine Erklärungen, warum dies oder jenes geschehen sei. Für all diese Aussagen und Zuschreibungen fehlen nicht nur jegliche historischen Belege. Sondern sie sind auch höchst unwahrscheinlich – zumindest für jeden, der mit der Welt des 16. Jahrhunderts nur ein bisschen vertraut ist. Das innere Drama von Zweigs Magellan spielt mithin nicht im 16., sondern im 20. Jahrhundert. Es ist eine Erfindung des Autors. Man könnte auch sagen: Es ist das innere Drama des Stefan Zweig.
Dieser Befund wäre nicht langer Rede wert, wenn Zweigs Geschichtsklitterung nicht bis heute eine derartige Wirkung ausüben würde. Zweigs Magellan ist Wind auf die Mühlen all derer, die noch immer glauben, dass die Geschichte (jedenfalls bis zum Amtsantritt von Angela Merkel) von großen Männern gemacht wurde. Von großen weißen Männern, versteht sich.
Anachronistisch ist dieses Geschichtsbild deshalb, weil Magellan für einen Großteil der Taten, die Zweig ihm zuschreibt, keineswegs verantwortlich war – für andere, von denen Zweig ihn freispricht, hingegen sehr wohl. Magellan hatte, soweit wir wissen können, niemals die Absicht, die Erde zu umrunden oder gar zu „beweisen“, dass die Erde rund ist. Nicht einmal die Idee, im Süden Amerikas eine Durchfahrt nach Asien zu suchen, stammte von ihm selbst. Dieses Ziel verfolgten seine Auftrag- und Geldgeber in Kastilien, der königliche Rat und Bischof Juan Rodríguez de Fonseca und der Kaufmann Cristóbal de Haro, schon mehr als ein Jahrzehnt, bevor sie Magellan an Bord holten. Fonseca und Haro waren die Drahtzieher des Molukken-Unternehmens. Magellans Rolle lässt sich am ehesten als die eines „Geschäftsführers im Außendienst“ beschreiben.
Zweigs Romanfigur Magellan ist, auch dies ein Anachronismus, ein typischer sozialer Aufsteiger, wie ihn die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts so verehrte: ein „unbekannter Soldat“, der aufgrund seiner außerordentlichen Talente eine atemberaubende Karriere macht. In Wirklichkeit gehörte Magellan qua Geburt einer hauchdünnen Schicht privilegierter Adliger an, und gewiss hat er niemals, wie Zweig sich zusammenfantasiert, eigenhändig ein Segel gerefft oder gar an einer Lenzpumpe geschwitzt. Dafür hatte man zu Magellans Zeit Schiffsjungen beziehungsweise Sklaven.
Die Flotte, die sich Magellan bei Stefan Zweig ganz allein aus eigener Kraft und nach eigener Idee erschuf, wurde in Wirklichkeit nach genauen Vorgaben Fonsecas von Beamten und Agenten der kastilischen Kolonialbürokratie auf Kiel gelegt, die in diesem Metier auf zwanzig Jahre Erfahrung zurückgreifen konnten. Auch die Tauschwaren, die die Flotte für den Handel mitführte, hat keineswegs Magellan aufgrund seiner vermeintlich langjährigen Erfahrung mit außereuropäischen „Naturkindern“ zusammengestellt, sondern wiederum Fonseca persönlich. Dafür war es Magellan, der in Patagonien aus eigener Initiative zwei großgewachsene Einheimische kidnappen ließ und zu diesem Zweck, wie Antonio Pigafetta in seinem Reisebericht bezeugt, eine schäbige List anwandte. Zweig fabuliert an dieser Stelle von einem angeblichen „Auftrag“ der spanischen Regierung, der nirgendwo dokumentiert ist, und schiebt die List den Matrosen in die Schuhe, die lediglich Magellans Befehle ausführten.

Bild: Arturo W. Boote. Photographe, Public domain, via Wikimedia Commons
Völlig anachronistisch ist schließlich auch Zweigs Darstellung der verschiedenen nicht-europäischen Gesellschaften, mit denen Magellan und seine Mannen im Lauf ihrer langen Fahrt zusammentrafen: die Tupi im heutigen Brasilien, die Vorfahren der Tehuelche im heutigen Patagonien, die Chamorros auf Guam, die Visayer auf den heutigen Philippinen und die Molukker. Für Zweig waren sie alle „Naturkinder“ und vor allem allesamt „braun“. Alle sind sie in seinem Roman ohne Unterschied kindliche, naive und zumeist gutmütige „Narren“, die zu den „weißen Göttern“ aus Europa ehrfurchts- und vertrauensvoll aufblicken.
Dass Europäer dieses Vertrauen allzu oft missbrauchten, beklagt der Humanist Zweig mit aufrichtigem Herzen. Seinen Helden Magellan will er von solcher Kritik freilich ausgenommen wissen (s.o.). Als Magellan auf den Visayas einige Dörfer mit Krieg überzog, um seinen Herrschaftsanspruch mit Gewalt zu untermauern, handelte er nach Zweig bloß aus einem „Gefühl der Pflicht“ heraus und weil er gegen einen „störrischen“ Häuptling „keine andere Wahl als das Argument der Waffe“ hatte. Bekanntlich verfügte sein Gegner, der Datu Lapulapu, über die stärkeren Argumente, und so fiel Magellan am 27. April 1521 im Kampf auf Mactan. Dass sein Held „durch ein lächerliches Menscheninsekt“, durch „einen braunen Lümmel, der keine ungeflickte Matte in seiner dreckigen Hütte“ hatte, „gefällt“ wurde, konnte Stefan Zweig offenbar nur schwer verwinden. An dieser Schlüsselstelle des Romans weicht die Attitüde wohlwollender Herablassung, die der Autor den „braunen Naturkindern“ gegenüber sonst an den Tag legt, unverhohlener Aggressivität.

Bild: Nmcast at English Wikipedia, lizensiert unter CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Die Menschen außereuropäischer Kulturen, mit denen Magellan auf seiner Fahrt zusammentraf, stellt Zweig durchwegs so dar, als stünden sie auf einer niedrigeren kulturellen und geistigen Entwicklungsstufe – so weit unten, dass ihre Kultur und Lebensformen gar nicht interessieren. Stattdessen werden sie unterschiedslos mit dem Klischee des unbedarft-gutmütigen Wilden belegt oder, wie „die Feuerländer“ im Vorbeifahren als „kulturell völlig niedere Rasse“ abgetan. Indem er den vermeintlichen Entwicklungsstufen menschlicher Gesellschaften eindeutige Hautfarben zuwies („braune Naturkinder“ – „weiße Götter“), benutzte Zweig einen rassistischen Code, der dem 16. Jahrhundert so fremd war, wie wir ihn heute unerträglich finden.
Das alles heißt natürlich keinesfalls, dass man Zweigs Magellan nicht mehr lesen oder das Buch gar auf irgendeinen Index setzen sollte. Aber wer es liest, sollte sich bewusst machen, dass er oder sie darin wenig über einen Seefahrer des frühen 16. Jahrhunderts erfährt, dafür umso mehr über die Fantasien eines österreichischen Großbürgers der 1930er Jahre, den die Selbstzerfleischung seiner eigenen Kultur ins Exil und in die Verzweiflung trieb.
Siehe auch:
Die fehlenden Strophen des Weltgedichts, erschienen am 24.10.2019 in Die Furche.
>> nach oben
Was 11.000 Jungfrauen mit einem Kap in Argentienien zu tun haben
Veröffentlicht am 20. Oktober 2020
Auch so ein Buch, das nur noch selten aufgeschlagen wird, ist der Heiligenkalender. Dabei findet man darin viele denkwürdige Geschichten. Zum 21. Oktober etwa die Legende von der Königstochter Ursula und ihren 11.000 Gefährtinnen, allesamt Jungfrauen, die auf der Heimreise von einem Papstbesuch per Schiff den Rhein hinabfuhren. Das soll um das Jahr 451 herum geschehen sein, zu der Zeit, als die Hunnen Europa in Angst und Schrecken versetzten. Bei Köln trieben Ursula und ihre Begleiterinnen den Hunnen geradewegs in die Arme. Die heidnischen Krieger machten die frommen Jungfrauen zu Märtyrerinnen, und weil Ursula dem Hunnenkönig einen Korb gab, tötete dieser sie eigenhändig.

Bild: Joachim Schäfer, Ökumenisches Heiligenlexikon
Über den mutmaßlichen Gräbern der Märtyrerinnen entstand im Mittelalter eine Kirche, St. Ursula zu Köln, und ihr Kult verbreitete sich über ganz Europa. Auch die christlichen Seefahrer, die am Ende des Mittelalters von Spanien und Portugal zu neuen Ufern aufbrachen, verehrten die Heiligen Jungfrauen, vielleicht weil auch diese, als sie das Martyrium ereilte, per Schiff unterwegs gewesen waren. So benannte Columbus nach ihnen eine Inselgruppe in der Karibik, die er auf seiner zweiten Fahrt 1493 besuchte: die heutigen Jungferninseln. Und als Ferdinand Magellan auf seiner Suche nach einem Seeweg in den Pazifik am 21. Oktober 1520 an der Küste Amerikas bei 52° 20′ südlicher Breite eine Landspitze sichtete, eine sandige Klippe am Rand der südamerikanischen Steppe, nannte er sie „Kap der Elftausend Jungfrauen“. Heute liegt das Kap in der argentinischen Provinz Santa Cruz, unweit der Grenze zu Chile, und heißt etwas knapper „Cabo Vírgenes“, also Jungfernkap.

Bild: Julio Viard – Colección privada, CC BY-SA 4.0
Als der fromme Katholik Magellan jenes Kap nach den legendären Elftausend Jungfrauen taufte, stiftete er, ohne es zu ahnen, einen neuen Gedenktag. Wenige Kilometer weiter südlich öffnet sich nämlich eine Bucht, und diese Bucht entpuppte sich als Einfahrt in die Meerenge, die zu suchen Magellan ein Jahr zuvor von Spanien ausgezogen war: die Wasserstraße, von der er hoffte, dass sie den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean verband und so einen westlichen Seeweg von Europa nach Asien eröffnete. Zwar benötigten Magellan und seine Gefährten mehr als fünf Wochen, um den westlichen Ausgang der gut 600 Kilometer langen Meerenge zu finden, denn wie man auf modernen Karten sieht, gleicht sie mehr einem Labyrinth aus Kanälen und Inseln als einer Straße. Aber der Tag, an dem die Seefahrer das Jungfernkap sichteten, ist in die Geschichte eingegangen als jener Tag, an dem die Meerenge, die heutige Magellanstraße, entdeckt wurde. Er liegt in diesem Jahr genau 500 Jahre zurück.
Der Weltreisende Antonio Pigafetta, der diesen historischen Moment miterlebt hat, schildert ihn in seinem Reisebericht wie folgt:
Kurz darauf, bei 52 Grad zum südlichen Pol, fanden wir durch ein riesengroßes Wunder am Tag der Elftausend Jungfrauen eine Meerenge, deren Landspitze wir Kap der Elftausend Jungfrauen nannten. Diese Meerenge ist hundertzehn Leugen lang, was 440 Meilen entspricht, und mehr oder weniger eine halbe Leuge breit. Sie führt in ein anderes Meer, Mar Pacifico genannt, und ist von sehr hohen, mit Schnee bedeckten Bergen umgeben. Wir konnten nirgends ihren Grund ausloten.
Wenn der Generalkapitän nicht gewesen wäre, hätten wir diese Meerenge nicht gefunden, denn wir alle meinten, dass sie ringsum geschlossen wäre. […] Der Kapitän schickte zwei Schiffe aus, Sancto Antonio und la Conceptione (so wurden sie genannt), um zu sehen, was sich am Ende der Bucht befand. Wir blieben mit den anderen beiden Schiffen – das Flaggschiff hieß Trinidade, das andere la Victoria – innerhalb der Bucht, um auf sie zu warten. In der Nacht überfiel uns ein starkes Unwetter, das bis zum anderen Mittag dauerte und uns zwang, den Anker zu lichten, sodass wir kreuz und quer durch die Bucht trieben.

Bild: Biblioteca Nacional de Chile
Die beiden ausgesandten Schiffe hatten starken Gegenwind. Sie wollten zu uns zurückkehren, waren jedoch nicht imstande, eine Landspitze fast am Ende der Bucht zu umrunden, und sahen sich schon genötigt, auf Grund zu laufen. Doch als sie sich dem Ende der Bucht näherten und bereits verloren wähnten, erblickten sie eine kleine Mündung, die keine Mündung zu sein schien, sondern eine Ecke. Wie Männer, die alle Hoffnung fahren gelassen haben, jagten sie hinein, sodass sie aus schierer Not heraus die Meerenge entdeckten.
Und als sie sahen, dass es keine Ecke war, sondern eine Meerenge im Land, fuhren sie voran und fanden eine Bucht. Danach fuhren sie noch weiter und fanden eine weitere Meerenge und eine weitere Brucht, beide größer als die vorherigen. Zutiefst beglückt wollten sie sogleich umkehren, um es dem Generalkapitän zu berichten.
Wir dachten derweil, sie seien zugrunde gegangen, zum einen wegen des heftigen Unwetters, zum anderen weil zwei Tage vergangen und sie nicht aufgetaucht waren. Auch wegen gewisser Rauchwolken, die zwei Abgesandte von ihnen an Land auftsteigen ließen, um uns zu benachrichtigen. Und wie wir so angespannt waren, sahen wir zwei Schiffe mit vollen Segeln und wehenden Fahnen auf uns zukommen. Als sie ganz nahe waren, feuerten sie plötzlich mehrere Bombarden ab, was wir mit Salutschüssen und Freudengeheul beantworteten. Daraufhin dankten wir Gott und der Jungfrau Maria und fuhren alle gemeinsam los, um weiterzusuchen.
Soweit der Augenzeuge Antonio Pigafetta. Der zitierte Text ist meiner Neuübersetzung seines Reiseberichts entnommen, die kürzlich in der wbg Edition erschienen ist:

Erstmals vollständig übersetzt und kommentiert von Christian Jostmann. 2020. 272 S. mit 31 farb. Abb. und 1 Kt., 14,5 x 21,5 cm, geb. mit SU. u. Lesebändchen, wbg Edition, Darmstadt. 28 Euro (22,40 für Mitglieder der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft)
>> nach oben
An Bord mit Magellan
Aktualisiert am 21. Dezember 2020
Warum sollte man ein fast fünfhundert Jahre altes Buch, das bereits mehrfach ins Deutsche übertragen wurde, nochmals übersetzen?
Weil das Buch wichtig ist und weil es von ihm bisher keine gute deutsche Übersetzung gab.
Das Buch, das ich meine, ist Antonio Pigafettas „Bericht von der ersten Reise rund um den Globus“. Der wohlgeborene Ritter aus Vicenza hatte 1519 bis 1522 an der ersten historisch belegten Umsegelung der Erde teilgenommen. Anders als die meisten seiner Mitfahrer überlebte er die Reise, sodass er nach der Rückkehr einen Reisebericht schreiben konnte. Sein Bericht ist die detaillierteste und lebendigste Erzählung eines Augenzeugen dieser historischen Fahrt. Pigafetta schildert das entbehrungsreiche Leben an Bord, die Gefahren und Abenteuer, die er und seine Mitstreiter durchstanden, und nicht zuletzt erzählt er von seinen zahlreichen Begegnungen mit anderen Menschen.

Bild: Wikimedia Commons
Pigafetta begegnete vielen Menschen, die zuvor nie oder kaum Kontakt mit Europäern gehabt hatten: den Tupi im heutigen Brasilien, den Tehuelche Patagoniens, den Chamorros auf Guam, den Visayern auf den heutigen Philippinen, den Einwohnern Mindanaos, Borneos, der Molukken und Timors. Die Arten und Weisen, wie all diese Leute lebten, sprachen, sich kleideten und ernährten, wie sie musizierten, Krieg führten, Sex hatten und ihre Götter verehrten, waren für Pigafetta und seine europäischen Zeitgenossen unerhört neu und fremdartig. Pigafetta beobachtete aufmerksam, stellte Fragen, lernte fremde Sprachen und schrieb auf, was ihm bemerkenswert erschien. So wurde er zum Ethnologen avant la lettre, der uns eine Beschreibung der Erde und ihrer Kulturen in den ersten Tagen der Globalisierung überliefert hat. Eine Beschreibung, die uns auch helfen kann, unsere Gegenwart, die mehr denn je von derselben Globalisierung geprägt ist, besser zu verstehen.
Habent sua fata libelli: Auch Pigafettas Buch hatte ein wechselvolles Schicksal. Zunächst nur in einer gekürzten französischen Übersetzung gedruckt, dann ins Italienische rückübersetzt, wurde Pigafettas ursprünglicher Text erst um 1800 in einer Mailänder Bibliothek wiederentdeckt. Er ist in einem Dialekt verfasst, wie man ihn im 16. Jahrhundert in Vicenza sprach. Allerdings meinte der Wieder-Entdecker von Pigafettas Bericht, der Mailänder Bibliothekar Carlo Amoretti, dass man dem Publikum die eigentümliche, oft derbe Sprache des Autors nicht zumuten könne. Daher „übersetzte“ Amoretti den Bericht ins moderne Italienisch und glättete dabei so manche Passage, die er als anstößig oder unklar empfand.
Mittlerweile gibt es längst originalgetreue Ausgaben von Pigafettas Buch: in der Originalsprache, in französischer und in englischer Übersetzung, es gibt Faksimile- und kritische Editionen. Nur im Deutschen gab es bis dato nichts dergleichen. Die einzige bisher hierzulande auf dem Buchmarkt erhältliche Ausgabe bringt einen vielfach gekürzten, an anderen Stellen willkürlich erweiterten Text, ohne dass Kürzungen oder Erweiterungen kenntlich gemacht wären; die Übersetzung selbst ist mitunter freizügig bis zur Sinnentstellung. Beispiel gefällig? Folgende Passage aus Pigafettas Bericht wurde in der bisher erhältlichen Edition kommentarlos gestrichen:
Eines Tages kam ein schönes junges Mädchen auf das Flaggschiff, wo ich mich aufhielt, zu nichts anderem, als um ihr Glück zu versuchen. Wie sie so abwartend dastand, warf sie einen Blick auf die Kajüte des Meisters und sah einen Nagel länger als einen Finger, den sie mit großer Vornehmheit und Anmut an sich nahm. Sie steckte ihn zwischen die Lippen ihrer Natur und verschwand heimlich, still und leise. Das sahen der Generalkapitän und ich.

Bild: Wikimedia Commons.
Weil ich fand, dass auch Leserinnen und Leser des Deutschen dieses wichtige und obendrein sehr unterhaltsame Buch in möglichst authentischer Form lesen können sollten, habe ich es direkt aus der Originalsprache, dem Venetischen des 16. Jahrhunderts, neu übersetzt. Und damit alle den Text einordnen und verstehen können, habe ich eine historische Einleitung und einen Fußnoten-Kommentar hinzugefügt, in dem alle fremdartigen Namen und Begriffe erklärt werden. Ganz besonders freut mich, dass die Neuausgabe auch die 23 farbigen Miniaturen enthält, die Pigafetta selbst seinem Werk beigegeben hatte und die bisher in keiner deutschen Ausgabe abgedruckt wurden.
Ich danke dem Deutschen Übersetzerfonds für ein großzügiges Arbeitsstipendium und dem Verlag wbg Edition für die schöne und hochwertige Ausgabe. Dank ihr kann man nun den „echten“ Pigafetta auch auf Deutsch lesen. Viel Spaß bei der Lektüre und – buon viaggio!

Erstmals vollständig übersetzt und kommentiert von Christian Jostmann. 2020. 272 S. mit 31 farb. Abb. und 1 Kt., 14,5 x 21,5 cm, geb. mit SU. u. Lesebändchen, wbg Edition, Darmstadt. 28 Euro (22,40 für Mitglieder der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft).
„Jostmanns Ziel war es, Pigafettas Bericht »in authentischer und zugleich lesbarer Form einem größeren Publikum auf Deutsch zugänglich zu machen«. Das ist ihm mit diesem Buch rundum gelungen.“ (Gerhard Schmitz in Spektrum der Wissenschaft)
„Pigafettas Bericht ist eine Kostbarkeit der Weltreiseliteratur. Seine Schilderungen der exotischen Länder und der Indigenen zeugen von einem neugierigen Blick auf das Fremde.“ (Hans-Christian Riechers in Der Tagesspiegel)
„Erst der Historiker Christian Jostmann liefert uns knapp 500 Jahre später mit dieser Version eine vollständige deutsche Übersetzung des historischen Abenteuerberichts. Dass er damit einen wichtigen Diskursbeitrag geleistet hat, liegt auf der Hand: Immerhin war es Pigafettas Reisetagebuch, das die Idee der Erde als Scheibe ins Wanken brachte. Und auch, dass im Jahr 1492 Indien entdeckt worden sei, zog er mit seinen Schilderungen beim aufmerksamen Leser in Zweifel. Nicht jedoch, ohne dabei ein eindrucksvolles Bild der Welt zu zeichnen, wie sie außerhalb der Komfortzone ist: wild, bunt, brutal, wunderschön und unbegreiflich weit.“ (Jenny W. Wirschky auf reciproque.de)
„Pigafettas von Christian Jostmann erstmals vollständig ins Deutsche übertragener und fachkundig kommentierter Bericht, regt zu vielen Fragen … an. Sie justieren unseren Blick auf das Eigene und das Fremde neu und fordern unsere Haltung zu Europas kolonialem Erbe heraus.“ (Frank Kaspar in Antonio Pigafetta: „Die erste Reise um die Welt“ – Augenzeuge der Kolonisierung (deutschlandfunkkultur.de)
>> nach oben
1000 Jahre Globalisierung?
aktualisiert am 31. August 2020
Kiwis aus Neuseeland, Ananas aus Costa Rica, Wein aus Chile – man muss nur in den Supermarkt gehen, um zu begreifen, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Doch wer meint, Globalisierung sei ein modernes Phänomen, irrt. Fritz Heichelheim, ein aus Nazideutschland vertriebener Althistoriker, erkannte schon bei den antiken Sumerern und Ägyptern vor 5000 Jahren Fernhandelsnetze, die sich von Nordafrika bis ins Innere Asiens erstreckten. Nicht ganz so weit in die Vergangenheit zurück geht Janet Abu-Lughods These vom spätmittelalterlichen „Weltsystem“. Während des Mongolenreiches, also zwischen 1250 und 1350 etwa, habe sich in weiten Teilen Asiens, Afrikas und Europas ein komplexes Netzwerk kommerziellen und kulturellen Austauschs etabliert. Da wurde Bernstein vom Baltikum bis nach China gehandelt, Elfenbein gelangte von Südafrika auf dem Seeweg nach Indien und weiter nach Ostasien, gefärbte Baumwollstoffe wurden von Indien nach Java exportiert, Porzellan und Seide von China in den Mittleren Osten, Gewürze von den Molukken bis nach Paris und London …
Dass Globalisierung gar nichts Neues sei, ist auch die Botschaft von Valerie Hansens Buch „The Year 1000. When Explorers Connected the World – and Globalization began“. Die in Yale lehrende Historikerin und China-Expertin hat zahlreiche Indizien dafür versammelt, dass Handel und kulturelle Kontakte bereits um die erste Jahrtausendwende sprunghaft zunahmen – und zwar weltweit.

Ihre literarische Tour um den Globus startet Hansen mit den Atlantikfahrten der Wikinger, die bekanntlich um das Jahr 1000 Grönland und das heutige Kanada ansteuerten. Folgt man der Autorin, dann sind die blonden Männer in ihren Langbooten noch ein gutes Stück weiter gekommen, nämlich bis zur mexikanischen Halbinsel Yucatan, wo Hansen sie und ihre Schiffe auf Wandbildern der Mayas identifiziert haben will.
Weil es die Wikinger nicht nur nach Westen trieb, skizziert Hansen anschließend ihre Umtriebe in Osteuropa. Dort reüssierten Skandinavier seit dem 8. Jahrhundert als Sklaven- und Pelzhändler und wirkten wohl auch an der Gründung des ältesten russischen Reiches mit, der Kiewer Rus. Der Sklavenhandel leitet zum nächsten Kapitel ihres Buches über, das sich den Beziehungen zwischen Afrika und der islamischen Welt widmet. Vor allem Bagdad, damals eine Millionenstadt, habe einen solchen Bedarf an Sklaven entwickelt, dass die Zahl der jährlich durch die Sahara verschleppten Menschen in die Tausende ging. Der Menschenhandel zwischen Afrika und dem Mittleren Osten, schätzt Hansen, habe über die Jahrhunderte fast so viele Opfer gefordert wie der transatlantische der Frühen Neuzeit, nämlich an die 12 Millionen.
Gänzlich anders geartet, aber laut Hansen nicht minder massiv waren Migrationsbewegungen, die sich um die erste Jahrtausendwende in Zentralasien abspielten. Der breite Steppengürtel zwischen Ungarn und Nordchina bot den berittenen Kriegern nomadischer Stämme, wie den Seldschuken, ideale Bedingungen, um die angrenzenden Reiche auszurauben oder zu unterwerfen. Nicht selten nahmen die Eroberer nicht nur die irdischen Reichtümer ihrer Opfer an sich, sondern auch deren religiöse Überzeugungen. So sorgten sie für die Ausbreitung des Islam und des Buddhismus in Zentralasien – auch dies eine Form der Globalisierung.
Was in Innerasien Pferde, leisteten auf dem Indischen Ozean Dschunke und Dhau: Die beiden Schiffstypen ermöglichten den Kontakt zwischen Kulturen und Völkern, die tausende Seemeilen entfernt voneinander lebten. Auf ihnen gelangten sowohl gefragte Güter wie Edelmetalle, Seide, Porzellan und Gewürze übers Meer als auch Mönche und heilige Texte. Am dichtesten gewoben war das Handelsnetz ganz im Osten Asiens, rund um die Südchinesische See, weshalb Hansen diese Region mit dem Etikett „The Most Globalized Place on Earth“ versieht. Während in den größten Städten Europas jener Zeit gerade mal ein paar tausend Menschen hausten, reichte die Einwohnerzahl der beiden chinesischen Häfen Guangzhou und Quanzhou bereits an die Million. Hier lebten Chinesen Tür an Tür mit Arabern und Indern, und auf den Märkten war alles käuflich von afrikanischem Elfenbein-Schmuck über in Malaysia gewobene Rattan-Matten bis zu aromatischem Sandelholz aus Timor (laut Hansen allerdings kaum Sklaven).

Bild: Wikimedia Commons
Für ihre Tour d’horizon durch die globalisierte Welt des Jahres 1000 ist Valerie Hansen zu danken. Sie lesend nachzuvollziehen kann unserem auf die Neuzeit fixierten Geschichtsbild und unserem Hang zum Eurozentrismus entgegenwirken. Auch wenn das in manchen Schulbüchern noch immer so steht: Die Globalisierung war keine Erfindung genialer oder – je nach Sichtweise – diabolischer Renaissance-Menschen aus Europa. Sondern ein Prozess, der lange vor 1500 in Gang war und – wie heute auch – von den verschiedensten Akteuren auf der ganzen Welt vorangetrieben wurde. Zweifellos konnten sich die europäischen Imperialisten der Frühen Neuzeit Netzwerke und Kommunikationswege zunutze machen, die sie fast überall auf der Welt vorfanden, von Tidore bis Tenochtitlán.
Dass und warum „die“ Globalisierung aber ausgerechnet um das Jahr 1000 herum begonnen haben soll, kann Hansen in meinen Augen nicht schlüssig begründen. Die meisten Handelsnetze, die sie in ihrem Buch beschreibt, waren um die erste Jahrtausendwende längst geknüpft, einige wie die beiden „Seidenstraßen“, die innerasiatische und die maritime, bestanden schon seit vielen Jahrhunderten. Auch hatten auf der Erde bereits weiträumige Expansionsprozesse stattgefunden, die bis heute nachwirken: von der Verbreitung des Buddhismus in Asien über den Indienzug Alexanders des Großen bis zur explosionsartigen Ausdehnung des Dar al-Islam ab etwa 630 – wohl einer der folgenreichsten Globalisierungsschübe überhaupt. 711 eroberten muslimische Krieger die iberische Halbinsel und 751 besiegten sie in der Schlacht am Fluss Talas, wo heute Kasachstan an Kirgistan grenzt, eine Armee der Tang-Dynastie. Ein in diesem Frühjahr erschienenes Handbuch beschreibt den Grad globaler Vernetzung, den Gesellschaften in Afrika, Asien und Europa bereits im Frühmittelalter (ca. 600-900 n. Chr.) erreicht hatten, also deutlich vor dem Jahr 1000.
Wenig überzeugend finde ich auch, die Fahrten des Wikingers Leif Eriksons nach Neufundland und Labrador (von der höchst spekulativen Präsenz der Nordmänner auf Yucatan ganz zu schweigen) sowie die Besiedlung des Pazifik durch die Polynesier ins Feld zu führen, um die These zu untermauern, die Globalisierung habe um das Jahr 1000 ihren Anfang genommen. Die Pazifik-Besiedlung erfolgte in mehreren Schüben; der letzte begann nach heutigem Wissensstand um 700 n. Chr. und endete gut 500 Jahre später mit der Besiedlung von Aotearoa (Neuseeland). Aber inwiefern stehen die Fahrten der Polynesier mit Migrationsbewegungen in Zusammenhang, die sich im selben Zeitraum anderswo auf dem Globus ereigneten? Da wir nicht wissen, warum sie in See stachen, lässt sich diese Frage allenfalls hypothetisch beantworten.
Jedenfalls waren vor der Neuzeit die meisten pazifischen Inseln einschließlich Papuas und Australiens so wenig in das Handelsnetz der „Alten Welt“ eingebunden wie der amerikanische Kontinent. Es macht eben einen Unterschied, ob eine Handvoll wagemutiger Pioniere den Weg zu fernen Gestaden fand oder ob sie auch den Rückweg meisterten, sodass dauerhafte Kontakte zustandekamen. Die Kanarischen Inseln wurden lange vor Christus von den Guanche besiedelt, doch in den tausend Jahren vor ihrer Eroberung durch Europäer im 14. Jahrhundert unterhielten jene keine Beziehungen zur Außenwelt. Desgleichen lebten die Rapa Nui der Osterinsel, die Chamorros auf Guam und die Maori auf Aotearoa bis zur Ankunft europäischer Seefahrer isoliert, und aus den Fahrten der Wikinger entstanden, anders als aus denen des Kolumbus, keine bis heute andauernden Verbindungen zwischen den Kontinenten. Die Skandinavier gaben ihre Siedlungen auf Grönland um 1400 wieder auf. Es ist daher irreführend, wenn Hansen schreibt, die von Vasco da Gama und Magellan „entdeckten“ Seerouten seien bereits tausend Jahre zuvor befahren worden. Aus Sicht der Globalisierung ist entscheidend, wann auf diesen Routen ein kontinuierlicher, langfristiger Austausch von Menschen, Waren und Ideen in Gang kam. Nach diesem Kriterium sind die Etablierung der portugiesischen Carreira da India nach 1498 und die Einrichtung der Manila-Galeone rund hundert Jahre später, die Amerika mit den Philippinen verband, nunmal Marksteine globaler Geschichte.

Bild: Wikimedia Commons
Den Begriff der „Globalisierung“ diskutiert Valerie Hansen in ihrem Buch nicht, sondern umschreibt ihn allenfalls vage: „This is, when trade routes took shape all around the world that allowed goods, technologies, religions, and people to leave home and go somewhere new.“ Nach dieser Definition hätte die Globalisierung nicht vor tausend, sondern bereits vor 100.000 Jahren begonnen, als die ersten Exemplare der Gattung Homo sapiens ihre afrikanische Heimat verließen, neue Lebensräume erschlossen und bald auch begannen, über längere Distanzen Dinge zu tauschen, wertvolle Steine zum Beispiel, was spätestens für das Jungpaläolthikum belegt ist. Die Unschärfe ihres Globalisierungsbegriffs schadet nach meinem Urteil Hansens Argumentation. Indem sie nicht nach der Wechselseitigkeit und Nachhaltigkeit der von ihr beschriebenen Kontakte fragt, übetreibt Hansen die schon oft beschworene historische Bedeutung der „mutation d’an mil“ (Dominique Barthélemy 1997) für die globale Geschichte. China mag um das Jahr 1000 der „Most Globalizend Place on Earth“ gewesen sein. Aber es war sicherlich nicht der Startplatz, von dem „die“ Globalisierung ihren Ausgang nahm. Von der Hochblüte der Song-Dynastie führte kein ununterbrochener historischer Pfad zu den Expansionsprozessen des 15. und 16. Jahrhunderts. An diesen nahm China, jedenfalls bis 1567, nicht aktiv teil.
Nun müssen in einer globalisierten Welt auch Bücher darum wetteifern, wahrgenommen und gekauft zu werden. Eine zugespitzte (wenn auch keineswegs ganz neue) These mag dabei helfen. Den nicht ganz uninformierten Leser freut sowas weniger. Aber trotz seiner begrifflichen Schwächen sei das Buch zur Lektüre empfohlen, zum einen wegen der Fülle des darin ausgebreiteten Materials, zum zweiten wegen der Zusammenhänge, die es herstellt, zum dritten weil es als Antidot gegen allzu bornierte Geschichtsbilder wirken kann (s.o.):
Update: Eine deutsche Übersetzung von Hansens Buch ist für September 2020 angekündigt.
>> nach oben
Neues von Pigafetta
Veröffentlicht am 19. Mai 2020
Es ist an der Zeit, wieder einmal von Antonio Pigafetta zu sprechen. Dem Ritter aus der norditalienischen Stadt Vicenza verdanken wir eines der schönsten Reisebücher der Weltliteratur, nämlich seinen Bericht über die erste Umrundung der Erde. Darin erzählt Pigafetta höchst anschaulich und lebendig von seiner Fahrt auf der Armada des Magellan, die ihn zwischen 1519 und 1522 von Spanien über Südamerika und den Pazifik bis zu den heutigen Philippinen, nach Borneo, zu den Molukken, nach Timor und um das Kap der Guten Hoffnung zurück nach Sevilla – kurzum: einmal rund um die Welt – führte.

(Bild: Biblioteca Nacional de Chile)
Bisher war Pigafettas Bericht auf Deutsch nur in gekürzten oder willkürlich umgearbeiteten Versionen erhältlich, die keinen authentischen Eindruck von diesem lesenswerten Text vermitteln. Ich habe mir daher, unterstützt vom Deutschen Übersetzerfonds, die Mühe gemacht, den gesamten Bericht nach der besten erhaltenen Handschrift, L 103 Sup. der Mailänder Biblioteca Ambrosiana, neu zu übersetzen. Und im Verlag wbg-Wissen verbindet habe ich einen kompetenten Partner gefunden, der meine Neuübersetzung im Druck herausgeben wird.
Neben der ersten vollständigen, originalgetreuen Übersetzung von Pigafettas Bericht ins Deutsche wird die Neuausgabe eine Einleitung und detaillierte Kommentare enthalten, die Leserinnen und Lesern der Gegenwart einen barrierefreien Zugang zur fernen Welt des frühen 16. Jahrhunderts ermöglichen. Außerdem werden darin erstmals sämtliche farbigen Miniaturen abgebildet sein, mit denen Pigafetta sein Werk geschmückt hat. Das Buch soll Mitte September erscheinen – ich freue mich schon sehr darauf!
>> nach oben
Verdachtsunabhängige Kontrolle
Veröffentlicht am 17. April 2020
Am 28. April 2020 begeht Österreich ein denkwürdiges Jubiläum. An diesem Tag ist es genau 25 Jahre her, dass Innenminister Caspar Einem in Brüssel das Schengener Übereinkommen unterzeichnete. Bis zu dessen Umsetzung sollte es danach noch etwas dauern. Erst seit Ende 1997 konnten Reisende die Grenze ohne – wie es in der Polizeisprache heißt – „verdachtsunabhängige Kontrolle“ passieren.
So war es auch, als meine Frau, eine gebürtige Österreicherin, und ich, ein deutscher Staatsbürger, im Frühjahr 2005 von Deutschland nach Österreich übersiedelten, um uns im Weinviertel niederzulassen. Niemand wollte an der Grenze unsere Pässe sehen und niemand interessierte sich für den Inhalt des Kleintransporters, mit dem wir unseren Hausrat in die neue, für meine Frau alte, Heimat überführten.

In den folgenden Jahren haben wir die Grenze ungezählte Male gequert: um Verwandte und Freunde zu besuchen, zu Familienfeiern, zu beruflichen Zwecken, oft allein, manchmal zu zweit, meistens mit den Kindern. Den Kindern erzählten wir beim Grenzübertritt gern, wie es früher war, als man noch kontrolliert wurde und mit Wartenzeiten rechnen musste. Dabei redeten wir wie alte Leute, wenn sie von längst vergangenen Dingen erzählen, die sich die Jüngeren nicht richtig vorstellen können. Von Dingen, die zwar von leiser Nostalgie umflort sein mochten, die aber ehrlicherweise niemand vermisste. Für eine österreichisch-deutsche Familie wie uns war „Schengen“ einfach nur ein Segen.

Wie segensreich die Schengener Bräuche gewesen waren, erfuhren wir, als wir Anfang 2016 wieder einmal nach Deutschland reisten. Gegen Mitternacht hämmerte es gegen die Tür unseres Liegewagenabteils und eine Männerstimme riss uns aus den Träumen: „Aufmachen! Bundespolizei. Passkontrolle!“ Auf meine verwunderte Frage, was wir uns denn hätten zuschulden kommen lassen, dass er unseren und unserer Kinder Schlaf störe, erklärte mir der Beamte, sie würden im Zug nach illegal einreisenden Personen suchen. Wohl um die Sinnhaftigkeit seines Tuns zu betonen, fügte er hinzu, dass sie in der vorherigen Nacht sogar eine solche Person aufgegriffen hätten.
Seither wurden Grenzkontrollen für uns wieder zur Normalität. Nicht nur erwarteten wir bei jedem Grenzübertritt, kontrolliert zu werden. Auch der Verkehrsfunk erinnerte uns regelmäßig an die veränderten Verhältnisse, wenn er die Wartezeiten an den Grenzübergängen durchgab. Aber auch diese andere Normalität, die im Herbst 2015 die Normen des Schengener Abkommens abgelöst hat, ist uns mittlerweile abhanden gekommen. Am 16. März 2020 wurde die Grenze zwischen Österreich und Deutschland vollends geschlossen, und sie wird es auch über den 28. April hinaus sein – diesmal allerdings nicht, um illegal einreisende Menschen, sondern um Coronaviren am Grenzübertritt zu hindern. Was aber auf dasselbe hinausläuft, weil nun alle Menschen im Verdacht stehen, Virenschmuggler zu sein.

Für meine österreichisch-deutsche Familie ist die Grenzschließung eine Zäsur im Wortsinn, schneidet sie uns doch in einem bislang nie erlebten Maß von unseren Verwandten und anderen lieben Menschen ab. Nicht de jure, weil alle deutschen Staatsbürger weiterhin das Recht haben, nach Deutschland einzureisen, aber de facto – und vor allem gefühlt.
Angesichts der uns verordneten Entkörperlichung fast aller zwischenmenschlichen Beziehungen mag das nebensächlich sein. Dennoch erscheint es mir bemerkenswert, dass Österreich unter solchen Vorzeichen das 25jährige Jubiläum seines Beitritts zum Schengener Übereinkommen begeht – und nicht etwa feiert, denn zu feiern wäre allenfalls die Öffnung der Grenze nach dem Abklingen der Pandemie. So denn die Grenze wieder geöffnet wird …

Am 15. April hat das deutsche Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass der Minister „aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen … die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landgrenze mit Wirkung zum 12. Mai 2020 für einen sechsmonatigen Zeitraum auf Grundlage der Art. 25 bis 27 des Schengener Grenzkodex neu angeordnet hat“.
„Schengen“ bleibt also – bis auf ministeriellen Widerruf – Geschichte. Damit aber nicht in Vergessenheit gerät, wie es zwischenzeitlich an den Grenzen aussah, stelle ich aus Anlass des „Jubiläums“ einige der Bilder online, die der Fotograf Bernd Ctortecka im Jahr 2005 an der österreichisch-deutschen Grenze aufgenommen hat. Die Bilder sollten seinerzeit eine Bestandsaufnahme liefern, im Jahr Zehn nach dem Schengen-Beitritt Österreichs. Sie waren gedacht als Einladung zur Reflexion, was das scheinbare Verschwinden der Staatsgrenzen ästhetisch und symbolisch bedeutete. Heute scheinen sie uns an eine Utopie zu erinnern, die vielleicht niemals Wirklichkeit geworden ist.
Weitere Info zum Schengen-Projekt (2005).
>> nach oben
Der Heilige Hiob auf Timor
Veröffentlicht am 23. März 2020
Am 25. Januar 1522 erreichte der italienische Ritter Antonio Pigafetta auf dem spanischen Dreimaster Victoria die Insel Timor. Pigafetta und seine Gefährten waren nicht die Ersten, die aus Europa nach Timor kamen. Portugiesische Schiffe liefen die Insel bereits seit ein paar Jahren immer wieder an, um ihren wichtigsten Exportartikel einzukaufen: Sandelholz. Die Victoria war allerdings das erste Schiff, das Timor, ja überhaupt Asien von Westen kommend ansteuerte, auf dem langen Weg um die Südspitze Amerikas herum und über den Pazifik. Und Pigafetta war der erste europäische Autor, der eine Beschreibung der Insel lieferte – in seinem „Bericht über die erste Umrundung der Erde“, den er nach der Rückkehr verfasste.

Neben anderen Details über die Lebensweise der Einheimischen, ihre Kleidung und Ernährung, die Sandelholzproduktion und die Herrschaftsverhältnisse auf Timor berichtete Pigafetta auch von einer Krankheit, die auf allen Inseln des Malaiischen Archipels grassiert habe, besonders stark aber auf Timor. Pigafetta nannte diese Krankheit „das Leiden des Heiligen Hiob“. Die Einheimischen würden sie allerdings „for franchi“ nennen, „das heißt portugiesische Krankheit“.

„Leiden des Heiligen Hiob“: Das war im Europa der Frühen Neuzeit ein Name für die Syphilis, eine Seuche, die am Ende des 15. Jahrhunderts erstmals in Italien massenhaft ausgebrochen war und von der man annimmt, dass Rückkehrer der Columbus-Expeditionen sie aus Amerika eingeschleppt hatten. Pigafettas Bericht zeigt, dass die Syphilis ein Vierteljahrhundert später bereits den äußersten östlichen Rand der „Alten Welt“ erreicht hatte, mutmaßlich an Bord portugiesischer Schiffe, waren diese bis dato doch die einzigen, die den Seeweg zwischen Europa und Asien befuhren. Daher nannten die Einheimischen sie „portugiesische“ oder wörtlich „fränkische Krankheit“.
Mit dem Adjektiv „fränkisch“ wurden in Indien und Südasien seit etwa der Zeit Karls des Großen allgemein Fremde belegt, die aus Europa kamen. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts waren das mehrheitlich Portugiesen, die durch Schiffs- und Geschlechtsverkehr einen Beitrag zur „unification microbienne du monde“ (Emmanuel Le Roy Ladurie) leisteten, zur „mikrobiellen Vereinigung der Welt“ im beginnenden Zeitalter der Globalisierung. In der vedischen Medizin heisst die Syphilis übrigens auch heute noch „firanga roga“: fränkische Krankheit
>> nach oben
Autorenlesung in Entringen
Aktualisiert am 28. Januar 2020
Am Donnerstag, den 23. Januar 2020, habe ich um 19:30 Uhr in der Nähe von Tübingen aus meinem aktuellen Buch Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde gelesen.
Veranstaltungsort war die mehr als 500 Jahre alte Entringer Zehnscheuer in der Gemeinde Ammerbuch, die von einem Kulturverein saniert wurde:

Hier ein Bericht über die Lesung im Schwäbischen Tagblatt vom 25. Januar 2020.
>> nach oben
„… dass wir die gesamte Rundung der Welt entdeckt haben.“
Aktualisiert am 12. Dezember 2019

„Spannend wie ein Seefahrer-Roman“ (Welt am Sonntag)
„Jostmann verflicht gekonnt die historischen Quellen zu einer spannenden Erzählung, ohne Überlieferungslücken mit Spekulationen zu füllen und somit den Sachbuchcharakter aufzuweichen.“ (Sebastian Hollstein in Spektrum der Wissenschaft)
„Ein Sachbuch wie man es sich wünscht, eines das fachlich kaum Fragen und stilistisch keine Wünsche offenlässt, das seine Geschichte in allen Details und in aller Ruhe auserzählt und so … eine tiefe Immersion schafft, die einen immer weiter ins Abenteuer hineinzieht. Für so ein Leseerlebnis lasse ich jeden Roman liegen.“ (dampierblog.de)
„In der neuesten Darstellung von Magellans Abenteuer bietet der Historiker Christian Jostmann eine nüchterne, indes nicht minder spannende, fachkundige und lesenwerte Narration.“ (Oliver vom Hove in Die Presse)
„Eine neue, gelungene Biografie …, die den Lebensweg des Portugiesen in spanischen Diensten spannend nacherzählt, gut recherchiert ist und sprachlich außerordentlich beeindruckt.“ (Alexander Querengässer in Zeitschrift für Geschichtswissenschaft)
„Der Mensch Magellan starb und sein Mythos begann. Jostmann nimmt den Mythos und zeigt uns den Menschen.“ (Ingo Löppenberg in Das Historisch-Politische Buch)
Auf Platz 5 der 10 besten Sachbücher für den Monat August – eine Empfehlungsliste der Literarischen Welt, Neuen Zürcher Zeitung, von WDR 5 und Radio Österreich 1.
Nach drei ausverkauften Auflagen:
Jetzt als Taschenbuch in C.H. Beck Paperback!
Wer mehr als nur die übliche Heldensaga vom „größten Seefahrer aller Zeiten“ (Stefan Zweig) lesen will, findet in meinem Buch „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“ alles, was ihn interessiert:
Wie kam es dazu, dass der portugiesische Ritter Fernão de Magalhães einen Vertrag mit dem kastilischen König schloss, um für ihn die Molukken zu „entdecken“, die legendenumwobenen Gewürzinseln?
Wie sahen die Schiffe aus, mit denen Magellan und seine Mannschaft am 20. September 1519 in See stachen, und wie wurden sie ausgerüstet? Wie war das Leben an Bord? Wie fanden die Steuermänner ihren Kurs?
Was erlebten die Seefahrer auf ihrer jahrelangen Reise, die einige von ihnen um den ganzen Globus führen sollte? Wie viele kehrten am Ende nach Europa zurück? Warf das Unternehmen tatsächlich einen Gewinn ab, wie immer behauptet? Und was bedeutete es für die Zeitgenossen, dass erstmals ein Schiff die Erde umfahren hatte?
Gratis zum Download (pdf):
>> nach oben
Erste Erdumrundung on air
Veröffentlicht am 13. September 2019
Am 10. August 1519 legte die spanische Armada zu den Gewürzinseln, deren Kommandant Fernão de Magalhães – Magellan – hieß, von Sevilla ab. Sie fuhr den Guadalquivir hinunter bis zu dessen Mündung und ging in einem Hafen bei Sanlúcar de Barrameda vor Anker. Dort blieb sie sechs Wochen, weil die fünf Schiffe noch mit Proviant und den Waren beladen werden mussten, die man im fernen Osten bzw. Westen gegen Gewürze eintauschen wollte. Am 20. September waren alle Arbeiten abgeschlossen, so dass die Armada endlich in See stechen konnte. Von vielen wird daher der 20. September 1519 als Beginn jener großen Reise angesehen, die als erste Umsegelung der Erde in die Geschichte eingehen sollte.

Dem Jubiläum widmet der Radiosender SWR2 von Montag, den 16., bis Freitag, 20.9., jeden Vormittag ab 9:05 Uhr eine „Musikstunde„, in der Stefan Franzen „den Seeweg der Portugiesen und Spanier mit Musik aus fünf Jahrhunderten, aus allen Kontinenten und Genres von Klassik über Jazz bis zu den jeweiligen Volkskulturen“ nachzeichnet. Eine musikalische See- und Zeitreise, auf die ich schon sehr gespannt bin.
In der Woche darauf – ab Montag, den 23.9. – wird sich der Rundfunksender Ö1 unter dem Titel „Die Erde ist keine Scheibe“ mit dem historischen Ereignis beschäftigen, und zwar an vier Vormittagen ab 9:30 Uhr für jeweils eine Viertelstunde. Zu diesem Radiokolleg habe ich Wissen beigesteuert, und ich bin abermals neugierig darauf, was Andreas Wolf aus dem Thema gemacht hat
Andere Radioanstalten haben bereits um den 10. August Beiträge über Magellan und die erste Erdumrundung gesendet.
Besonders gelungen finde ich nach wie vor das „Zeitzeichen“ auf WDR5, das Ralph Erdenberger zum Anlass produziert hat. Zu empfehlen gerade auch für jüngere Hörerinnen und Hörer!
Mehr um die historischen Hintergründe und die Einordnung geht es im folgenden Beitrag, den der Deutschlandfunk im Rahmen der Reihe „Wendepunkte: Vorher – Nachher“ gebracht hat: „Gier, Ruhm und der Wettlauf der Nationen“.
Viel Spaß beim (Nach-) Hören!
>> nach oben
Ein halbes Jahrtausend …
Aktualisiert am 13. August 2019
… ist es nun her, dass vom Puerto de las Muelas in Sevilla fünf Schiffe ablegten. Es war der 10. August 1519, ein Mittwoch und Festtag des heiligen Lorenz. Zuvor hatte sich die Besatzung in der Kirche Santa Maria de la Vitoria zum Abschiedsgottesdienst versammelt, und der Statthalter des kastilischen Königs hatte dem Kommandanten der Flotte die Standarte überreicht. Danach waren alle zum Hafen gezogen, wo die Schiffe, mit Wimpeln geschmückt und schwarz glänzend vom Pech, vertäut lagen. Salutschüsse donnerten über den Fluss. Ein Schiff nach dem anderen stieß vom Ufer ab, die Focksegel gingen hoch, Bug um Bug drehte sich stromabwärts. Noch am selben Tag brach ein Eilbote nach Barcelona auf, um die Nachricht an den Hof Karls I. zu bringen: Die Molukken-Armada hatte endlich abgelegt!
Sie sollte dem kastilischen König gebührenden Anteil am Handel mit kostbaren Gewürzen bescheren, die im fernen Indien gediehen. Das zumindest hatte der Kommandant der Flotte, ein portugiesischer Ritter namens Fernão de Magalhães, den man hierzulande als Magellan kennt, dem König versprochen. Magellan wollte finden, was schon zahllose Seefahrer vor ihm vergebens gesucht hatten: einen westlichen Seeweg nach Indien, und so den östlichsten Teil von Asien kastilischer Herrschaft unterwerfen. Doch seine Rechnung ging nicht ganz auf.

Von jener Flotte, die am 10. August 1519 von Sevilla ablegte, kehrte am Ende nur ein Schiff zurück: die „Vitoria“. Ihr Befehlshaber hieß Juan Sebastián Elcano, denn Magellan war auf den Philippinen (die damals noch nicht so hießen) im Kampf mit deren Einwohnern gefallen, nachdem er und seine Crew tatsächlich einen westlichen Seeweg nach Asien gefunden hatten – durch eine Meerenge im tiefen Süden Amerikas, die heute „Magellanstraße“ heißt. Erstaunlicher noch: Die „Vitoria“ kehrte, nachdem sie die Molukken angefahren hatte, über das Kap der Guten Hoffnung nach Spanien zurück und hat damit als erstes Schiff, von dem man weiß, die gesamte Erde umrundet. Daher gedenken wir in diesen Tagen der ersten historischen Erdumsegelung.
Hören Sie mehr darüber im „Zeitzeichen“ des WDR-Hörfunks zum 10.8.1519, von und mit Ralph Erdenberger.
Oder lesen Sie mein Buch:

Christian Jostmann: Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde. 336 S., mit 11 Abb. und 2 Karten. Verlag C.H. Beck, München 2019. 24,95 Euro (D).
Eine ausführliche neue Rezension des Buches finden Sie jetzt auf dampierblog.de.
>> nach oben
Spektroskopie
Veröffentlicht am 24. Juni 2019
Als Autor freue ich mich naturgemäß, wenn meine Bücher wahrgenommen, gelesen und mehr noch wenn sie rezensiert werden. Ein Buch zu schreiben, zumal ein umfangreiches, hat über lange Zeit etwas von einem Monolog an sich. Von einem Monolog, bei dem ich mir als Autor nicht sicher sein kann, ob jemand zuhört oder zuhören wird. Bis dann – hoffentlich! – Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern eintrudeln, die das Buch gut oder weniger gut fanden, denen jenes gefallen und anderes nicht so gefallen hat. Dann erst wird für mich die Sache rund, weil aus dem Monolog ein Dialog und somit echte Kommunikation entstanden ist.
Daher freue ich mich auch stets über Rezensionen, und diese dürfen, ja sie sollen bitte auch kritisch sein – solange ich spüre, dass die Verfasserin oder der Verfasser sich ernsthaft mit dem Buch auseinandergesetzt hat. Besonders erfreulich finde ich es, wenn ein Rezensent in meinem Buch genau das gefunden hat, was ich versucht habe hineinzulegen. Und wenn er das dann auch noch in einer gut geschriebenen Besprechung an prominenter Stelle veröffentlicht. Daher bin ich sehr glücklich über diese Rezension von Sebastian Hollstein auf spektrum.de:
>> nach oben
Das Pigafetta-Projekt
VeröffentlichT am 3. Juni 2019
In den Jahren 1519 bis 1522 umsegelte erstmals ein Schiff nachweislich die gesamte Erde von Ost nach West. Zu den wenigen Überlebenden dieser epischen Fahrt, die der Portugiese Ferdinand Magellan im Auftrag der spanischen Krone initiiert hatte, gehörte Antonio Pigafetta, ein Patrizier aus Vicenza. Pigafetta schrieb nach der Rückkehr ein Buch über seine Erlebnisse, das heute als Klassiker der Reiseliteratur gilt.
Pigafetta war der erste, der in Europa von fremden Kulturen wie den Patagoniern (die von ihm ihren Namen erhielten), den Chamorros auf Guam, den Visayas auf den heutigen Philippinen, von fernen Inseln wie Borneo und Timor berichtete. Er begegnete dem Fremden mit Neugier und erstaunlich wenig Vorurteilen; und er wusste seine Erfahrungen in Worte zu kleiden, die nicht nur seinen Zeitgenossen eine ferne Welt näherbrachten, sondern diese auch für Leserinnen und Leser des 21. Jahrhunderts wieder lebendig werden lassen.
Von Pigafettas anhaltender Bedeutung kündet eine Vielzahl von Studien, Editionen und Übersetzungen aus dem Venezianischen, etliche davon jüngeren Datums. So erschien 2007 eine vorzügliche Neuausgabe des französischen Pigafetta im Pariser Verlag Chandeigne.

Wer jedoch Pigafettas Reisebericht auf deutsch lesen möchte, muss auf einen verstümmelten Text zurückgreifen. In der einzigen auf dem hiesigen Buchmarkt erhältlichen Ausgabe ist der Originaltext an mehreren Stellen verkürzt, dafür sind andere Passagen hinzugefügt, die nicht aus Pigafettas Feder stammen, ohne dass die Kürzungen und Hinzufügungen als solche kenntlich gemacht wären. So wurde etwa folgender Abschnitt über den Aufenthalt der Flotte in der Guanabara- Bucht (Rio de Janeiro) kommentarlos gestrichen (Übersetzung von mir):
„Ein schönes Mädchen kam eines Tages auf das Flaggschiff, wo ich mich aufhielt, einfach nur um anzubandeln. Wie sie so abwartend dastand, warf sie einen Blick in die Kajüte des Meisters und sah dort einen Nagel, länger als ein Finger. Den nahm sie mit großer Vornehmheit und Anmut an sich, schob ihn zwischen die Lippen ihrer Natur und verschwand plötzlich, wobei sie sich ganz klein machte. Dies sahen der Generalkapitän und ich.“
Man muss kein Philologe oder Historiker sein, um derartige Eingriffe in einen Text, der zu den großen der Weltliteratur zählt, inakzeptabel zu finden. Eine zeitgemäße Neuausgabe von Pigafetta Reisebericht für ein deutsch lesendes Publikum ist überfällig, und ich bin überzeugt, dass eine solche auch am Buchmarkt ihre Käuferinnen und Käufer fände.
>> nach oben
Werk.Gänge
Veröffentlicht am 18. Mai 2019
Ein Abend, auf den ich mich besonders freue:
Die Literaturkritikerin und Feuilleton-Chefin der Furche, Brigitte Schwens-Harrant, hat mich nach Wien in die Österreichische Gesellschaft für Literatur zu einem Autorengespräch eingeladen. Sie wird mir mir unter anderem „über das Verhältnis von Literatur und Historie sprechen und über die Kunst, Geschichte zu recherchieren und zu erzählen.“ Im Laufe des Abends werde ich auch aus meinen Büchern lesen.
Österreichische Gesellschaft für Literatur
Palais Wilczek, Herrengasse 5, Stiege 1, 2. Stock
1010 Wien
Montag, 27. Mai 2019
19 Uhr
Der Eintritt ist frei.
>> nach oben
Ankündigung: Lesung bei München
Veröffentlicht am 24. April 2019
Am Samstag, den 4. Mai, werde ich im Rahmen der Unterhachinger Lesenacht aus meinem neuen Buch Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde lesen – und zwar gleich zweimal:
um 19 Uhr im KUBIZ (Jahnstraße 1, Unterhaching)
um 21 Uhr in der Gemeindebücherei (Rathausplatz 11)
Ich freue mich über jede Zuhörerin und jeden Zuhörer!
Weitere Infos und Kartenreservierung unter: www.unterhachinger-lesenacht.de
>> nach oben
Schall und Rauch
Veröffentlicht am 31. März 2019
„Magellanstraße“ heißt seit dem 16. Jahrhunderts eine Meerenge im tiefen Süden Amerikas. Benannt wurde sie nach Ferdinand Magellan, dem Seefahrer, der sie entdeckte. Er allein? Hisste Magellan die Segel seines Schiffes etwa selbst?

Rund 240 Männer stachen am 20. September 1519 mit Magellan von der spanischen Atlantikküste in See, unter ihnen viele erfahrene Seeleute. Da war der ehrgeizige Steuermann Estevão Gomes, ohne den Magellan die Einfahrt in die Meerenge schwerlich gefunden hätte. Da war Andrés de San Martín, seines Zeichens Kosmograph, der Längengrade messen konnte mit einer Präzision, die damals ihresgleichen suchte. Da waren der baskische Schiffmeister Juan Sebastián Elcano und der Bootmann Francisco Albo aus Rhodos, die das letzte Schiff von Magellans Armada, die Vitoria, zurück nach Sanlúcar steuerten und damit die Umrundung der Erde vollendeten. Und da waren Matrosen wie Leone Pancaldo aus Savona, Nicolao de Nápoles oder Juan Rodríguez „el Sordo“ (der Taube), um nur ein paar wenige von ihnen zu nennen.
Als ich mein Buch über Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde schrieb, wollte ich nicht ein weiteres Mal das oft gesungene Lied auf den vermeintlichen Helden dieser Tat anstimmen. Vielmehr war es mir ein Anliegen, auch von denen zu erzählen, die in den meisten Darstellungen nicht genannt werden, deren Namen heute nur noch wenigen Experten geläufig sind, ohne die aber Magellans berühmte Expedition nie zustande gekommen wäre. Allerdings können die vielen Namen in Magellans Geschichte einem Leser oder einer Leserin bald spanisch vorkommen. Daher haben wir dem Buch ein Personen- und Ortsregister beigegeben. Zusätzlich gibt es ab jetzt und hier ein Verzeichnis der wichtigsten Personen als Pdf gratis zum Download:
Personenverzeichnis zu Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde
>> nach oben
Magellan-Mythen
Veröffentlicht am 8. März 2019
Wir wissen nicht allzu viel über Magellan, jenen Ritter portugiesischer Herkunft, der im September 1519 als Befehlshaber einer kleinen spanischen Flotte in See stach, um einen neuen Seeweg zu den Molukken zu erschließen, den Gewürzinseln in Südostasien. Aus seinem Leben vor dieser Reise, die seinen Namen unsterblich machen sollte, sind nur spärliche Daten bekannt. Manch einer hat versucht, die Lücken mit Legenden zu füllen. So ist mit der Zeit ein Magellan-Mythos entstanden, reich an Ausschmückungen und spekulativen Elementen, die in Ermangelung harter Fakten weitererzählt werden.
So liest man oft, Magellan sei (um) 1480 im nordportugiesischen Dorf Sabrosa geboren. Allein die Jahreszahl ist nicht mehr als bloße Vermutung. Magellan lebte in einer Zeit, die sich noch nicht dem Datensammeln verschrieben hatte. Es gab weder Geburtsurkunden noch Kirchenbücher, geschweige denn Melderegister. Das älteste gesicherte Dokument, das eindeutig auf seine Person verweist, ist eine Mannschaftsliste aus dem Jahr 1505. Damals schiffte Magellan sich auf der Flotte des Vizekönigs Dom Francisco de Almeida von Lissabon nach Indien ein. Über sein Alter zu diesem Zeitpunkt verrät die Liste nichts, außer dass er wohl kein Knabe mehr war.
Sicher ist hingegen, dass Magellan der namhaften Adelssippe der Magalhães entstammte, die ihren Stammsitz in der Terra da Nóbrega hatte und deren zahlreiche Familienzweige sich über weite Teile Nordportugals erstreckten. Der Vorname Fernão war in der Familie offenbar sehr beliebt: Im 15. und 16. Jahrhundert lässt sich ein halbes Dutzend verschiedener Träger des Namens „Fernão de Magalhães“ ausmachen – was es naturgemäß erschwert, den „richtigen“ Magellan ausfindig zu machen.
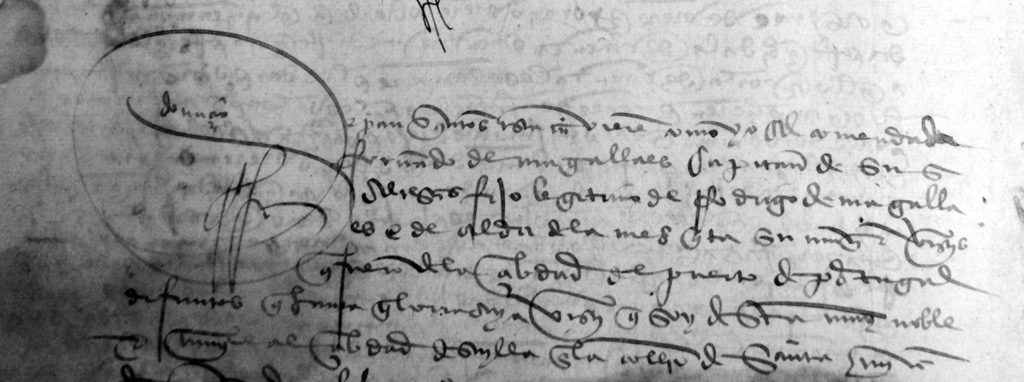
Die beiden wichtigsten Dokumente, die ein wenig Licht in das Dunkel von Magellans Herkunft bringen, stammen aus dem Jahr 1519 – dem Jahr seiner Abreise zu den Molukken. Das eine ist sein Testament, das die Namen seiner Eltern und Geschwister nennt, darunter den seiner Schwester Ysabel. Das zweite ist ein Schenkungsvertrag zugunsten eben dieser Schwester. Ihr vermachte Magellan vor seiner Abfahrt das Landgut, das er als Erstgeborener von seinen bereits verblichenen Eltern Rui und Alda geerbt hatte. Das Landgut befand sich in Vila Nova de Gaia, unweit von Porto südlich des Douro, und umfasste Weinberge, Kastanienhaine und Äcker zum Getreideanbau. Wenn man über den Ort spekulieren möchte, wo Magellan geboren wurde und aufwuchs, dann sprechen die Fakten eindeutig für Porto beziehungsweise Vila Nova de Gaia. Das Dorf Sabrosa hat Magellan wahrscheinlich nie betreten.
Der Schenkungsvertrag lag fast ein halbes Jahrtausend im Archiv der Notare von Sevilla verborgen. Erst vor wenigen Jahren haben Historiker überhaupt Notiz von ihm genommen. Außer wenigen Fachleuten dürfte er kaum jemandem bekannt sein. In meinem Buch „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“ habe ich dieses Dokument – so wie eine Vielzahl anderer – natürlich berücksichtigt. In diesem Buch hinterfrage ich den schon so oft erzählten Magellan-Mythos mittels Quellenkenntnis und -kritik. Damit versuche ich zu zeigen, dass Magellans Geschichte auch ohne spekulative Ausschmückungen und Legenden erzählenswert ist:

Christian Jostmann: Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde. 336 S., mit 11 Abb. und 2 Karten. Verlag C.H. Beck, München 2019. 24,95 Euro (D).
>> nach oben
Buch ahoi!
Veröffentlicht am 13.02.2019
Seit dieser Woche im Buchhandel erhältlich: mein neues Buch über den Seefahrer
Ferdinand Magellan und die erste Umsegelung der Erde!

1519 bis 1522 segelte zum ersten Mal (soweit wir wissen) ein Schiff einmal rund um den Globus. Die „Santa Maria de la Vitoria“ war etwa 25 Meter lang, hatte drei Masten plus Bugspriet und 45 Mann Besatzung (von denen bei der Rückkehr noch 18 am Leben waren: Magellan selbst zählte nicht zu den Heimkehrern).
Die Vitoria lief Brasilien an, entdeckte die Magellan-Straße, überquerte als erstes europäisches Schiff den Pazifik, besuchte – ebenfalls als erstes europäisches Schiff – die heutigen Philippinen und Borneo, erreichte schließlich nach zwei Jahren auf hoher See die Molukken und kehrte von dort um das Kap der Guten Hoffnung in ihren Heimathafen Sevilla zurück:
Drei Jahre voller Abenteuer, Entbehrungen und Kämpfe, die in diesem Buch wieder zum Leben erweckt werden!
Ein Buch für Geschichtsfreaks, Segler.innen und Freizeit-Skipper, Armchair-Traveller und alle, die mehr über die Vorgeschichte unserer modernen globalisierten Welt erfahren möchten. Alles höchst seriös recherchiert und gut lesbar aufbereitet. Und der Verlag C.H. Beck hat dem Text wieder eine sehr ansprechende äußere Form gegeben. Das ideale Geschenk für die Frau ebenso wie den Mann von Welt! Aber auch ein Buch zum Selber-Schmökern!
Christian Jostmann: Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde. 336 S., mit 11 Abb. und 2 Karten. Verlag C.H. Beck, München 2019. 24,95 Euro (D).
>> nach oben
Der (un)romantische Magellan
Veröffentlicht am 28.01.2019
Am 14. Februar erscheint mein neues Buch „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“. Dass es am Valentinstag auf den Markt kommt, ist meines Wissens reiner Zufall. Denn um Romantik geht es in dem Buch eher nicht – jedenfalls nicht im landläufigen Sinn. Wenn man unter Romantik allerdings eine kulturhistorische Epoche versteht, dann schon. Ist doch der „Held“ des Buches, Ferdinand Magellan, eine literarische Erfindung der Zeit um 1800.

Damals entdeckte Carlo Amoretti in der Mailänder Biblioteca Ambrosiana den Bericht Antonio Pigafettas über die „Erste Reise um den Erdglobus“ wieder und rief mit seiner Publikation ein großes Echo hervor. Pigafetta war 1519 von Sevilla aus auf einer kleinen Flotte in See gestochen, die einen westlichen Seeweg zu den Molukken finden sollte, den sagenumwobenen Gewürzinseln Südostasiens. Fast auf den Tag genau drei Jahre später kehrte eines der Schiffe zurück und überbrachte, neben einer Ladung Gewürznelken, dem kastilischen König die Sensationsnachricht, „dass wir die gesamte Rundung der Welt entdeckt und umrundet haben, indem wir nach Westen weggefahren und von Osten zurückgekehrt sind“.
Die Forscher und Entdecker des 19. Jahrhunderts – Männer wie Alexander von Humboldt – erblickten in den Seefahrern der Frühen Neuzeit heroische Vorläufer ihrer eigenen Bestrebungen. Sie erklärten und verklärten die Weltumsegler zu Pionieren der Welterkundung, allen voran Ferdinand Magellan, unter dessen Kommando die Flotte 1519 in See gestochen war. Magellan hatte die Reise zwar nicht überlebt. Aber der schriftstellerisch begabte Pigafetta war, was seinen toten Kommandanten anging, des Lobes voll: Magellan habe sich „auf das Kartenlesen und die Navigation genauer [verstanden] als sonst irgendein Mann auf der Welt“, und kein anderer habe „so viel Genie und Eifer“ besessen, „um einmal die Welt umrunden zu können, wie er es fast getan hatte“.
Im 19. Jahrhundert – einer Zeit, da Genies in Europa Hochkonjunktur hatten – rannte Pigafetta mit solchen Worten offene Türen ein. Magellans literarisches Schicksal war besiegelt. Er galt fortan als genialer Seefahrer und Entdecker. Seither tragen auch die beiden Nachbargalaxien der Milchstraße seinen Namen: Magellansche Wolken.

Um diesen Magellan – die literarische Figur des 19. Jahrhunderts – geht es in meinem neuen Buch nur am Rande. Es handelt vor allem von der historischen Gestalt, die dieser Figur zugrunde liegt: dem portugiesischen Ritter Fernão de Magalhães. Und es erzählt von der Zeit, in der er lebte: dem Zeitalter der Entdeckungen, als sich das Netz menschlicher Kommunikation und des Kommerzes vollends über den Globus legte.
Was trieb Leute wie Magalhães um? Welche Ziele verfolgten ihre Auftraggeber, Geschäftspartner und Reisegefährten? Wie sahen die Schiffe aus, auf denen sie segelten? Was aßen sie unterwegs? Was wussten sie über die Erde und die Gestalt ihrer Oberfläche? In was für einer Gesellschaft lebten sie? Und wie gingen sie mit Menschen aus anderen Kulturen um, denen sie unterwegs begegneten? Diese und andere Fragen versuche ich in meinem Buch „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“ zu beantworten.
Dabei beziehe ich mich als Historiker auf die Dokumente, Berichte und sonstigen Überbleibsel, die aus der Vergangenheit erhalten sind. Aus ihnen rekonstruiere ich die Geschichte des Fernão de Magalhães und seiner Zeit. Für alle Interessierten gibt es ab jetzt und hier gratis zum Download eine (englischsprachige) Einführung in die Quellen und die historische Literatur, die ich für das Buch herangezogen habe:
>> nach oben
Mit Magellan um die Welt
Veröffentlicht am 07.01.2019
Als im Herbst 2015 so viele Menschen nach Europa kamen, um hier Schutz und ein besseres Leben zu suchen, hatte das auch Auswirkungen auf mein Leben. Ich habe mich in einem Flüchtlingshilfeprojekt in unserer Gemeinde engagiert und ich begann, einen Blog zu schreiben. Die Ankunft der Fremden hatte mich daran erinnert, dass auch ich ein Fremder war in diesem Land. Also habe ich eine Zeit lang über mein Leben als „Zugeroaster“ im österreichischen Weinviertel berichtet, wo ich seit 2005 ansässig bin [http://fremd-in-der-heimat.blogspot.com].
In den ersten zehn Jahren meines Aufenthaltes hatte ich die Österreicherinnen und Österreicher als durchweg freundliche, vielfach herzliche und oft gescheite Menschen schätzen gelernt, die augenscheinlich ein Talent dafür hatten, es sich selbst und anderen gut gehen zu lassen. Doch im Jahr 2016 änderte sich schlagartig die Stimmung im Land, und viele meiner Mitbürger (und manche meiner Mitbürgerinnen) zeigten ein ganz anderes Gesicht. Im Gespräch mit ihnen erlebte ich nun immer öfter eine Hartherzigkeit, die mich erschreckte. Inzwischen weiß ich, dass diese Hartherzigkeit keine österreichische Eigenart ist, sondern überall regiert (oder zu regieren trachtet), wo wir Wohlhabenden uns vor den Hungerleidern fürchten.
Die damalige Innenministerin der Republik, jetzige Landeshauptfrau von Niederösterreich, versprach den Österreichern, Europa zu einer „Festung“ zu machen. Dieses Versprechen warf in mir manche Fragen auf: War es überhaupt in der Praxis einlösbar? Wenn ja, mit welchen Mitteln? Und wie würde es sein, in einer Festung zu leben?
Als Historiker fragte ich mich zudem, was die Befestigung des Kontinents für seine Geschichte bedeutete. Handelt diese doch seit einem halben Jahrtausend von der Entdeckung, Eroberung und Unterwerfung der Welt durch Europäer, also dem Gegenteil von Abschottung. Die globale Expansion ging einst von Europa aus und sie geht als wirtschaftliche Expansion immer weiter, auch wenn die europäischen Staaten die Herrschaft über ihre Kolonien verloren haben und sie längst nicht mehr die einzigen „global players“ sind.
Weil ich mehr wissen wollte über diese Geschichte, habe ich mich im Sommer 2016 im altmodischen Vehikel des Historikers auf die Reise gemacht und bin den Spuren eines ihrer Protagonisten gefolgt: jenen des berühmten Seefahrers Ferdinand Magellan, eigentlich Fernão de Magalhães.

Der Portugiese befehligte 1519 eine spanische Flotte, die eine westliche Route zu den Molukken finden sollte, den Gewürzinseln in Südostasien. Er entdeckte einen Seeweg vom Atlantik in den Pazifik, die heute nach ihm benannte Magellan-Straße, und kam bis zu den Visayas auf den heutigen Philippinen, wo er am 27. April 1521 im Kampf mit Einheimischen starb. Seine Gefährten setzten die Reise fort. Eine Handvoll von ihnen erreichte im September 1522, nach knapp drei Jahren, wieder den Heimathafen Sevilla – von Osten aus. Damit hatten sie als erste Menschen, von denen wir wissen, den gesamten Globus umrundet.
Mehr als zwei Jahre lang bin ich Magellans Spuren durch die Literatur und die Archive nachgegangen. Ich bin in die Lebenswelten frühneuzeitlicher Kaufleute, Ritter und Seefahrer eingetaucht, habe in alten Chroniken geschmökert, notarielle Urkunden transkribiert, Heuerlisten und Rechnungsbücher durchgekämmt. Schließlich bin ich virtuell in See gestochen und im Kielwasser von Magellans Schiffen einmal um die ganze Welt gereist.
Unterwegs habe ich einige fremde Kulturen kennengelernt, angefangen mit den Portugiesen und Spaniern des 16. Jahrhunderts, über die Tupi Brasiliens, die Vorfahren der Tehuelche in Patagonien und die Chamorros auf Guam, bis hin zu den Visayas und Molukken. Kurzum, ich habe im Kopf eine abenteuerliche Zeit- und Weltreise unternommen, von der ich nun in meinem neuen Buch berichte.
Es heißt „Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde“ und erscheint am 14. Februar 2019 im Verlag C.H. Beck.

















